Nach der Vorstellung der Bildtafeln zur Fernmeldetruppe Elektronische Kampfführung (EloKa) des Heeres (1957 — 2002) und zu den EloKa-Kräften in der Streitkräftebasis ab 2002 wird die Serie zu o.a. Bildtafelausstellung mit Anmerkungen zu den Bildtafeln über die Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr fortgesetzt.
Oberst a.D. Peter Uffelmann
Vorgeschichte der Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr
Die ersten Anfänge der Führungsdienste von Marine und Luftwaffe reichen bei der Marine bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. bei der Luftwaffe bis kurz vor das Ende des 19. Jahrhunderts zurück: Bei der Marine begann 1873 die Ausbildung von Telegraphisten für ihre Landstationen, die per Kabel zunächst noch an das Telegraphennetz der Preußischen Staatstelegraphie, ab 1876 an das der Deutschen Reichspost angeschlossen waren, während im Jahr 1897 erste militärische Versuche mit „Funkentelegraphie“ bei der Luftschifferabteilung in Berlin unter Nutzung von deren Ballonen und Drachen zum Ausbringen einer ca. 200 — 300 m langen Antenne den Anfang des luftgestützten Führungsdienstes markieren — auch wenn Letzteres zunächst noch der Informationsübermittlung des Heeres diente.
Die diesen ersten militärischen Versuchen mit „Funkentelegraphie“ vorangegangene Vorführung der Funkentelegraphie für Wilhelm II. im Jahr 1897 führte auch dazu, daß die Marine ab ca. 1898 begann, ihre Schiffe und Boote mit Funkanlagen auszustatten, während bis dahin weitgehend nur der optische Signaldienst (Signalflaggen — Winkspruchverfahren — Morseverkehr mit Scheinwerfern) zur Informationsübermittlung zu und zwischen Schiffen in See gedient hatte: Schon im Jahr 1900 wurde jedoch in der offiziellen Zeitschrift „Der Nauticus“ des Reichsmarineamtes das gute und sichere Arbeiten der Funkentelegraphie hervorgehoben sowie, daß mehrjährige praktische Erprobung bei der Marine ihre Brauchbarkeit erwiesen hat und so waren 1912 bereits 112 deutsche Kriegsschiffe (= 64%) mit Funktelegraphen ausgestattet. 1914 verfügten dann alle 175 Schiffe und Boote der Kaiserlichen Marine je nach Größe über Funkstationen mit mindestens einem oder mehreren Sendern(n) und „Marine-Universal-Zellen- und/oder Marine-Aptierter-Ticker-Zellen-Empfänger(n)“, wobei “Zelle” die damals gebräuchliche Bezeichnung für Kristalldetektor war.


Marine-Universal-Zellen-Empfänger „MUZE C 12“ (20 — 750 kHz) und Marine-Aptierter-Ticker-Zellen-Empfänger „MATZ II“ (30 — 750 kHz), Bilder: https://seefunknetz.de/muze.htm und https://seefunknetz.de/matz2.htm
Als Antennen wurden Reusen-Antennen1 an bzw. zwischen den Schiffsmasten genutzt.
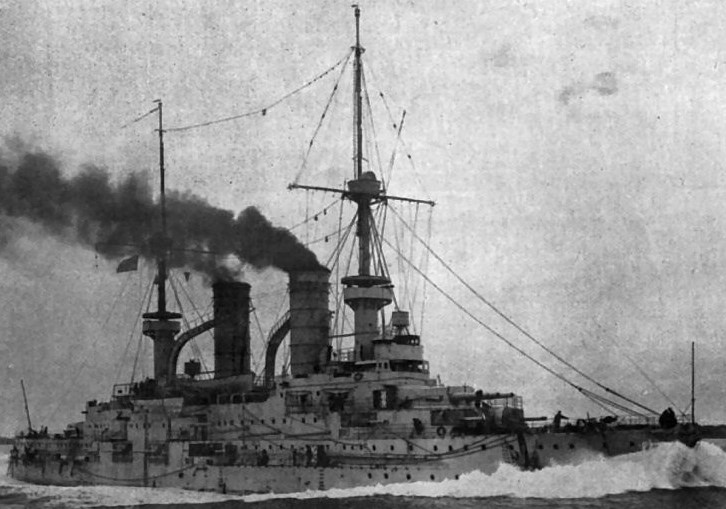
Masten und Aufbauten eines deutschen Schlachtschiffs um 1905,
Bild: Wikipedia
Das Bedienungspersonal für Funkentelegraphiegeräte war dabei schon 1899 den „Werftdivisionen“2 zugeordnet worden, trug deren Uniform mit silberfarbenen Knöpfen sowie Mützenbändern — im Gegensatz zu den goldfarbenen des seemännischen Personals — und wurde als „Funker“ bezeichnet, welche ab 1910 an dem besonderen Ärmelabzeichen „Anker mit Blitz“ erkennbar waren. Ab 1910 wurde es zudem in der Funkmeisterlaufbahn mit den Dienstgraden „Funker“ und „Funktelegraphen-Maat“ zusammengefaßt, die im Laufe des I. Weltkriegs um den Dienstgrad „Funktelegraphenmeister“ im Deckoffiziersrang3 erweitert wurde.
Ab Herbst 1901 wurde in Flenburg-Mürwik zunächst auf dem Torpedoboot „Blücher“ — und wenige Jahre später auf dem Torpedoboot „Württemberg“ — eine Marine-Funkentelegraphie-Ausbildungsstätte eingerichtet sowie ein erster Funkentelegraphie-Lehrgang durchgeführt.
In allen Marine-Landstandorten an der Nord- und Ostseeküste entstanden zudem Küstenfunkstellen für den See-Land- und den Land-See-Funkverkehr: U.a. wurde ab 1905 die Küstenfunkstelle „Norddeich“ eingerichtet, mit der ab Sommer 1905, lange vor ihrer offiziellen postalischen Inbetriebnahme in 1907, die ersten Funkversuche zum See-Land- und Land-See-Funkverkehr durchgeführt wurden — in erster Linie zur sicheren Funkabdeckung des westlichen Bereichs der deutschen Bucht bis hin zum Ärmelkanal insbesondere für Kriegsschiffe.
Im April 1906 konnte dabei der Kleine Kreuzer „München“ die bakenartig ausgestrahlten Morsezeichen in bis zu 400 km Entfernung aufnehmen. Im Juli desselben Jahres wurde dann 600 km als maximal mögliche Empfangsentfernung erprobt. Weitere Reichweitentests durch die Herstellerfirma Telefunken ergaben, daß Morsezeichen der Knallfunkensender aus Norddeich auf 150 kHz selbst in über 1.600 Kilometer Entfernung noch zu empfangen waren.
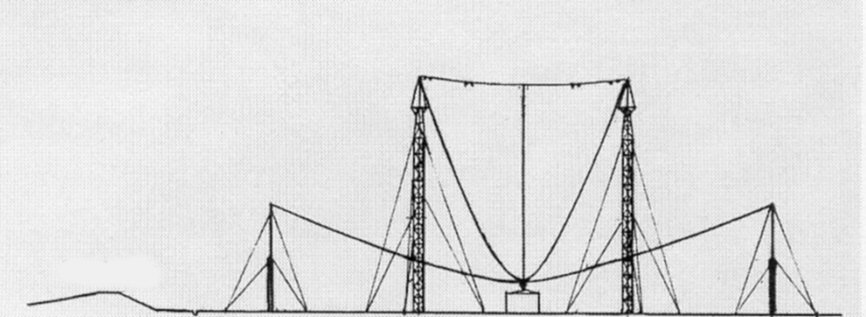
Bild 4: Rekonstruktion der ersten Antennen-Anlage in Norddeich 1906,
Quelle: www.pust-norden.de/gal_ndd_dt.htm
Nachdem man im Jahr 1907 die Antennenmasten um zehn Meter aufgestockt hatte, stellte man erneut Reichweitenrekorde mit Hörempfang über 2.200 km auf. Als technische Innovation wurden später in Norddeich zwei der 1908 von Telefunken entwickelten Löschfunkensender installiert, die mit 2,5 kW bzw. 10 kW sowie nochmals um 20 Meter erhöhten Antennen die maximale Reichweite auf mehr als 3.000 Kilometer abermals steigerten. Um 1912 herum begann man dann damit, Horizontal-Antennen zu testen und ergänzte nach erfolgreichen Versuchsreihen die bisherigen vertikalen Antennensysteme um eine fest installierte Horizontalantenne, mit der es in 1913 gelang, im Langwellenbereich ausgestrahlte Meldungen selbst in über 5.000 Kilometer Entfernung aufzunehmen.
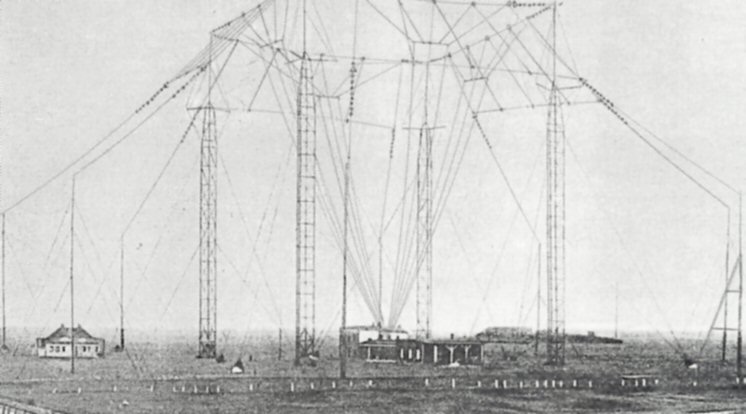
Norddeicher Langwellen-Antennenanlage (Foto um 1911),
Quelle: www.pust-norden.de/gal_ndd_dt.htm
Wenn die Marine Manöver durchführte, übernahmen Marine-Funker den Betrieb der Küstenfunkstelle „Norddeich“ vom sonst im Schichtdienst eingesetzten Reichspostpersonal, die dann zusätzlich noch durch Landwehr-Infanteristen aus Aurich gesichert wurde.
Etwa 1907/08 begann die Marine auch mit der Überwachung des Funkverkehrs der britischen Royal Navy, aber nicht um Einblicke auf chiffriertechnischem, geschweige denn auf taktischem oder operativem Gebiet zu gewinnen, sondern nur um den Stand der funktechnischen Entwicklung in der Royal Navy festzustellen und zu verfolgen — durchgeführt wurde dies von der Marine-Funkstelle auf Helgoland, dem Fischereischutzkreuzer „Zieten“ und einem zur Erprobung von Nachrichtenübertragung genutzten Fischdampfer — mit dem Ergebnis, d.h. den funktechnischen Erkenntnissen war man offensichtlich zufrieden, die Feststellungen allerdings, daß die Royal Navy ihren Funkverkehr weitgehend unverschlüsselt abwickelte sowie Rufnamen verwendete, die ähnlich wie deutschen gebildet wurden und verhältnismäßig leicht zuzuordnen waren, hätten jedoch zu denken geben müssen.
Funkaufklärung zur Gewinnung taktisch oder operativ nutzbarer Informationen hat die Kaiserliche Marine — wie offensichtlich auch die Royal Navy — demnach vor 1914 nicht betrieben und erst ab 1912, jedoch dann fortlaufend wurde der deutsche Admiralstab über die Ergebnisse der zwar nur in bescheidenem Umfang, aber systematisch betriebenen österreichisch-ungarischen Marine-Funkaufklärung gegen die italienische, französische und britische Marine im Mittelmeer informiert.
Nach den o.a. ersten militärischen Versuchen mit „Funkentelegraphie“ bei der Luftschifferabteilung im Jahr 1897 nahmen am Kaisermanöver 1900 erprobungshalber erstmals zwei bei der Luftschifferabteilung gebaute „Ballonstationen“ teil, da die seit Oktober 1899 neue Inspektion der (Heeres-)Telegraphentruppen jegliche Zuständigkeit für die „Funkentelegraphie“ ablehnte, und erzielten Reichweiten von bis zu 28 km. Auch am Kaisermanöver 1902 nahmen erneut versuchsweise zwei Ballon-Funkstationen der Luftschifferabteilung teil, diesmal zur Verbindung mit der zur Aufklärung eingesetzten Kavallerie-Division: Mit dem Morseschreiber wurden dabei Verbindungen bis auf zwei Tagesmärsche (bis zu ca. 45 km), mit dem Hörapparat auf drei bis vier Tagesmärsche (ca. 67 — 90 km) noch sicher hergestellt.
Da die Inspektion der Telegraphentruppen auch dann noch die Übernahme der „Funkentelegraphie“ in ihren Zuständigkeitsbereich weiterhin ablehnte, wurde daraufhin ab Oktober 1902 eine kompaniestarke „Funken-Telegraphenabteilung“ aus Freiwilligen und kommandiertem Personal beim Luftschiffer-Bataillongebildet.
1903 erhielt das Luftschiffer-Bataillon die erste fahrbare, von 6 Pferden gezogene Ballon-Funkstation: In Marschlage wurde der Ballon, welcher die Antenne beim Betrieb etwa 200 — 300 m hoch hob, gefüllt über dem Fahrzeug transportiert — zu Einzelheiten siehe Post 9.

„Ballon-Funken-Station“,
Bild: Bildtafel 14
Im Rahmen der Verstärkung der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika (heute: Namibia) im Frühjahr 1904 zur Niederschlagung des Herero-Aufstands wurde ab Ende April — ergänzend zu den bereits dort vorhandenen stationären Funkstellen — auch ein „Detachement zur Bedienung von Funkentelegraphiestationen in Südwestafrika“ in Zugstärke aus Freiwilligen als Funken-Telegraphenabteilung „Südwestafrika“ beim Luftschiffer-Bataillon aufgestellt — zu Einzelheiten siehe Post 10.
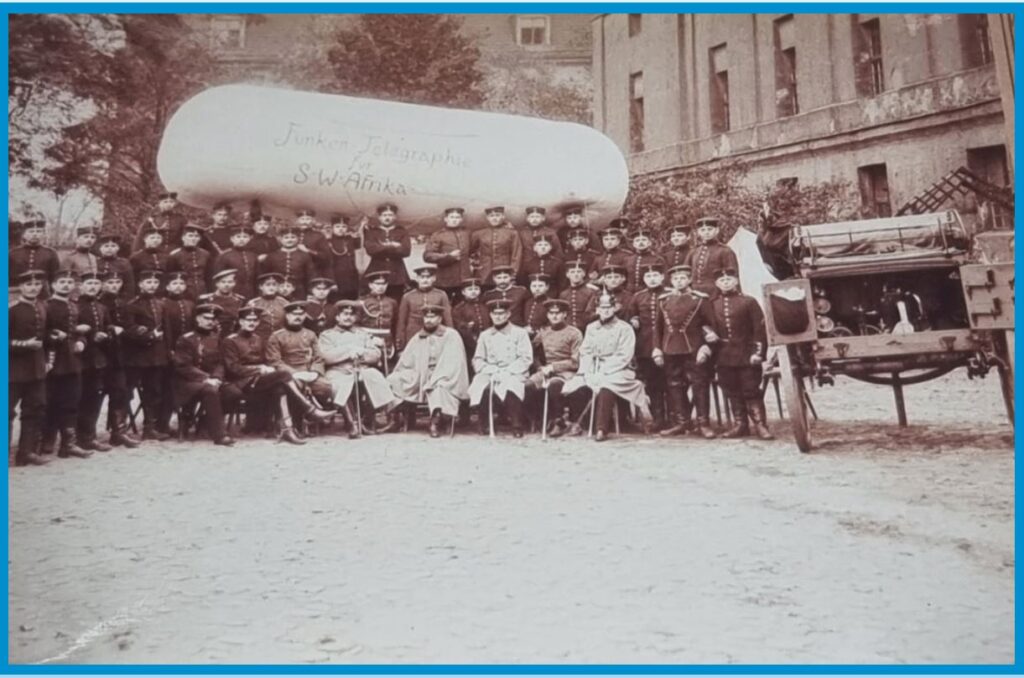
Bild 7: Funken-Telegraphenabteilung „Südwestafrika“ ,
Bild: Bildtafel 15
Zu ihrer Ausrüstung zählten drei verlegefähige Funkstationen, wobei zur Anpassung an afrikanische Verhältnisse die Funkkarren mit acht Ochsen, die Funkwagen mit 20 Ochsen bespannt wurden — zu Einzelheiten siehe Post 10.
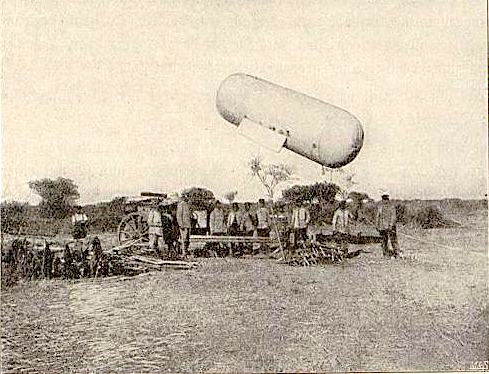
Bild 8: Ballon-Funkstation in Deutsch-Südwestafrika,
Bild: Post 10
Aus den Erfahrungen der Schlacht am Waterberg (zu Einzelheiten siehe Post 10) setzte man im Krieg gegen die Nama ab Ende 1904 insbesondere auf weitere Funkstationen: Um somit bei der Operationsführung flexibler zu sein, bekam die Funken-Telegraphenabteilung im Februar 1905 Verstärkung durch eine weitere Funken-Telegraphenabteilung, die weitgehend aus schnell angelernten Soldaten bestand, da das Luftschifferbataillon nicht genügend ausgebildetes Funkpersonal hatte. Nach einem längeren Marsch in den vorgesehenen Einsatzraum und nachfolgenden Instandsetzungsarbeiten war diese zweite Funken-Telegraphenabteilung erst ab Anfang Mai 1905 einsatzbereit.
Im August 1906 waren jedoch dann die großen Operationen der Schutztruppe im Nama-Krieg vorbei und es schloss sich ein Guerillakrieg an, der für die Funkstationen weniger Aufgabenfelder bot, da die Schlachtfelder klein und weit verstreut waren — Ende September 1906 erfolgte deshalb die Auflösung der 2. Funken-Telegraphenabteilung: Das Personal teilte man den Kompanien der Schutztruppe zu, das Material wurde als Gerätereserve in ein Funken-Telegraphiedepot abgegeben und bei Ende der Operationen in 1907 wurde das Gerät der beiden Funken-Telegraphenabteilungen in Windhoek gesammelt (zu Einzelheiten siehe Post 10).
Mit Unterstellung der „Funken-Telegraphenabteilung“ beim Luftschiffer-Bataillon ab Mai 1905 unter Telegraphen-Bataillon Nr. 1 endete vorerst die Vorgeschichte eines eigenständigen luftgestützten Führungsdienstes, aber bereits ab 1907 waren alle Luftschiffe des Luftschiffer-Bataillon mit Funkgeräten ausgestattet, mit denen ab 1910 Funkverkehr mit Bodenstationen durchgeführt wurde und wodurch schon sehr bald erkannt wurde, daß elektromagnetische Wellen nicht nur zur Übermittlung von Nachrichten geeignet waren, sondern auch zur Navigation: Etwa ab 1912 wurden deshalb Peilanlagen zur Orts- und Richtungsbestimmung von Luftschiffen eingesetzt, während dagegen die Nutzung von Funkgeräten in Flugzeugen bis 1914 aus dem Versuchsstadium noch nicht herausgekommen war.
Etwa ab 1915 aber konnte die deutsche Industrie leistungsfähige Funkempfänger und ‑sender für Flugzeuge bereitstellen, so daß ab Anfang August 1915 Boden-Bord- und Bord-Boden-Funkverkehr mittels Morsetelegraphie — ab 1918 auch Sprechfunk — möglich wurde, was rasch zunehmend immer mehr genutzt wurde. Im Zusammenhang mit der Schlacht um Verdun ab Ende Februar 1916 führte dieser zunehmende Funkverkehr der Aufklärungsflugzeuge, besonders aber der Artillerieflieger zur Feuerleitung zwischen den an Bord befindlichen Vorgeschobenen Beobachtern (VB) der Artillerie und ihren Gegenstellen am Boden — insbesondere beim Einschießen der Artillerie — im Juni 1916 zur Bildung einer eigenständigen „Fliegerfunktruppe“, für welche die Telegraphentruppe Funkpersonal bereitgestellt hatte und die auch die Funk-Weitverbindungen zu den gegen Großbritannien eingesetzten Luftschiffen sowie ersten Bombenflugzeugen betrieb und deren Positionen per Funkpeilung ermittelte. Ab Juli 1916 betrieb diese neue „Fliegerfunktruppe“ an der Westfront auch eine zentrale Organisation zur Warnung vor gegnerischem Fliegereinsätzen durch Erfassung des damit verbundenen Flugfunks und durch Ortung der mit Funkgeräten ausgestatteten gegnerischen Flugzeuge.
Mangels zentraler Koordination des Funkeinsatzes der „Fliegerfunktruppe“ mit dem der Telegraphentruppe kam es aber auch zunehmend zu gegenseitigen Störungen des jeweiligen Funkbetriebs, was während Sommer und Herbst 1916 zum sogenannten „Funkerstreit“ zwischen dem Chef der Feldtelegrapie sowie dem „Feldflugchef“ eskalierte, der Mitte November zunächst zur auch offiziellen Aufstellung der „Fliegerfunktruppe“ führte, aber im Folgejahr durch die OHL dann doch weitgehend zugunsten der Telegraphen-/Nachrichtentruppe entschieden wurde: Die „Flieger-Funktruppe“ blieb ab 1917 nur noch für Entwicklung und Beschaffung der Bordfunkgeräte verantwortlich, während die Verantwortung für die Bodenfunkgeräte der ca. 250 „Fliegerhafenstationen“ und den Funkbetrieb insgesamt der Nachrichtentruppe übertragen wurde. Im Januar 1918 wurde dann das gesamte Personal und Gerät der „Flieger-Funktruppe“ in die Nachrichtentruppe eingegliedert — zu Einzelheiten siehe Post 12 und 13. Damit endete auch die Vorgeschichte eines eigenständigen Führungsdienstes der späteren Luftwaffe in der Wehrmacht.
Im Bereich der Marine führten im August 1914 Navigationsfehler zum Aufgrundlaufen des Kleinen Kreuzers „Magdeburg“ im dichten Nebel bei der Insel Odinsholm/Odensholm/Osmussaar vor der Nordwestküste von Estland, so daß ein deshalb über Bord geworfenes, durch Bleideckel beschwertes Signal- bzw. Codebuch („Signalbuch der Kaiserlichen Marine“ = SKM) zur Codierung und der Kriegssignalbuchschlüssel zur Verschlüsselung u.a. des deutschen Marine-Funkverkehrs durch russische Marinetaucher geborgen wurden sowie ein weiteres SKM noch an Bord gefunden wurde, von denen eines dieser Signal- bzw. Codebücher an den britischen Marinenachrichtendienst und dessen Entzifferungsbüro für deutschen Marine-Funkverkehr („Room 40“) übergeben wurde, was diesem dadurch die Möglichkeit eröffnete, den deutschen Marinefunkverkehr durch Entzifferung der mit einem Buchstaben-Ersatz-/-Tauschverfahren („Monoalphabetische Substitution“) verschlüsselten und mit dem Signal- bzw. Codebuch codierten Funksprüche bis zur Neuordnung des Schlüsselwesens der Kaiserlichen Marine in 1917 mitlesen bzw. auch nach dem damit verbundenen Wechsel des Codebuchs aufgrund dessen unveränderter Systematik weiter entziffern zu können — mit im Weiteren teilweise katastrophalen Folgen für die Kaiserliche Marine, z.B. Versenkung der Masse des Ostasiengeschwaders (Panzerkreuzer „Scharnhorst“ und „Gneisenau“, Kleine Kreuzer „Leipzig“ und „Nürnberg“ sowie Versorger „Santa Isabel“ und „Baden“) Anfang Dezember 1914 im Seegefecht bei den Falklandinseln durch zwei überlegene britische Schlachtkreuzer, nachdem dieses durch einen von den Briten vorgetäuschten, angeblich deutschen Funkspruch dorthin gelockt worden war; Versenkung des Panzerkreuzers „Blücher“ Ende Januar 1915 beim Seegefecht auf der Doggerbank nachdem der deutsche Befehl zur dortigen Aufklärung über Funk durchgegeben worden war und am 31. Mai/1. Juni 1916 — nachdem die Ankündigung zum Auslaufen der gesamten deutschen Hochseeflotte über Funk durchgegeben worden war — sowie Versenkung des Schlachtkreuzers „Lützow“, des Schlachtschiffs „Pommern“ sowie von vier Leichten Kreuzern und fünf Zerstörern in der Skagerak-Schlacht, die dazu führte, daß der deutschen Hochseeflotte der Zugang zur nördlichen Nordsee und zum Nordatlantik verwehrt blieb sowie die britische Seeblockade aufrechterhalten werden konnte, auch wenn die britische Admiralität und die Führung der „Grand Fleet“ nicht immer Ergebnisse ihrer Marine-Funkaufklärung in so verwertbarer Form erhielten.
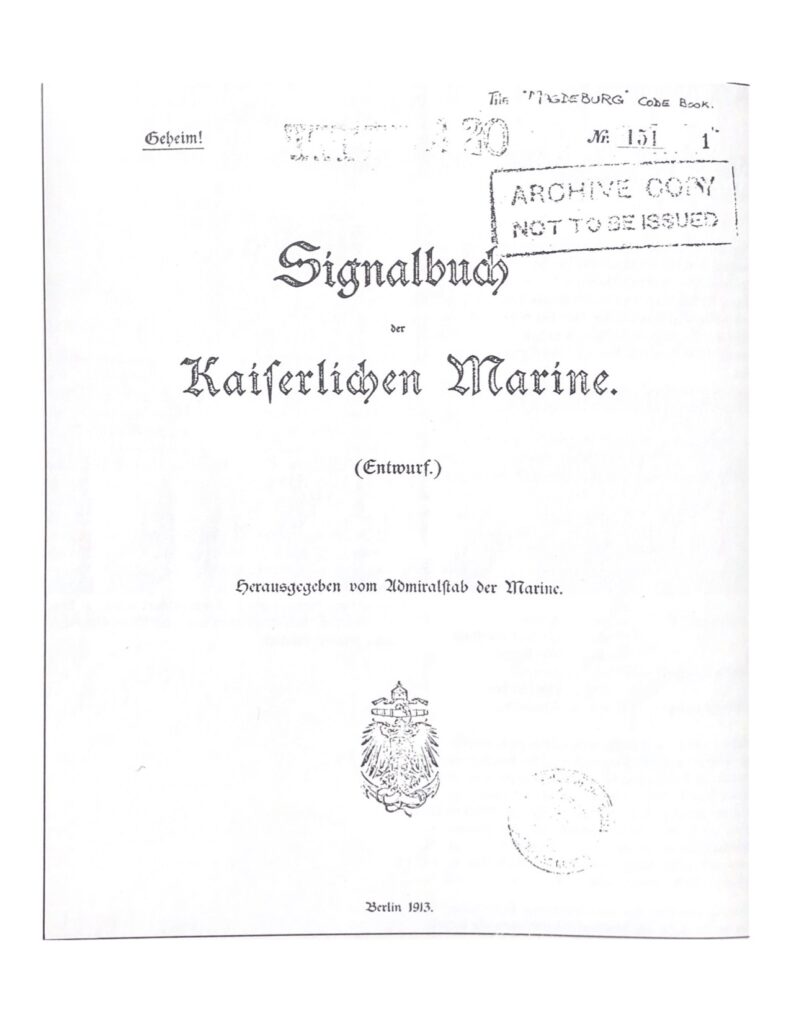
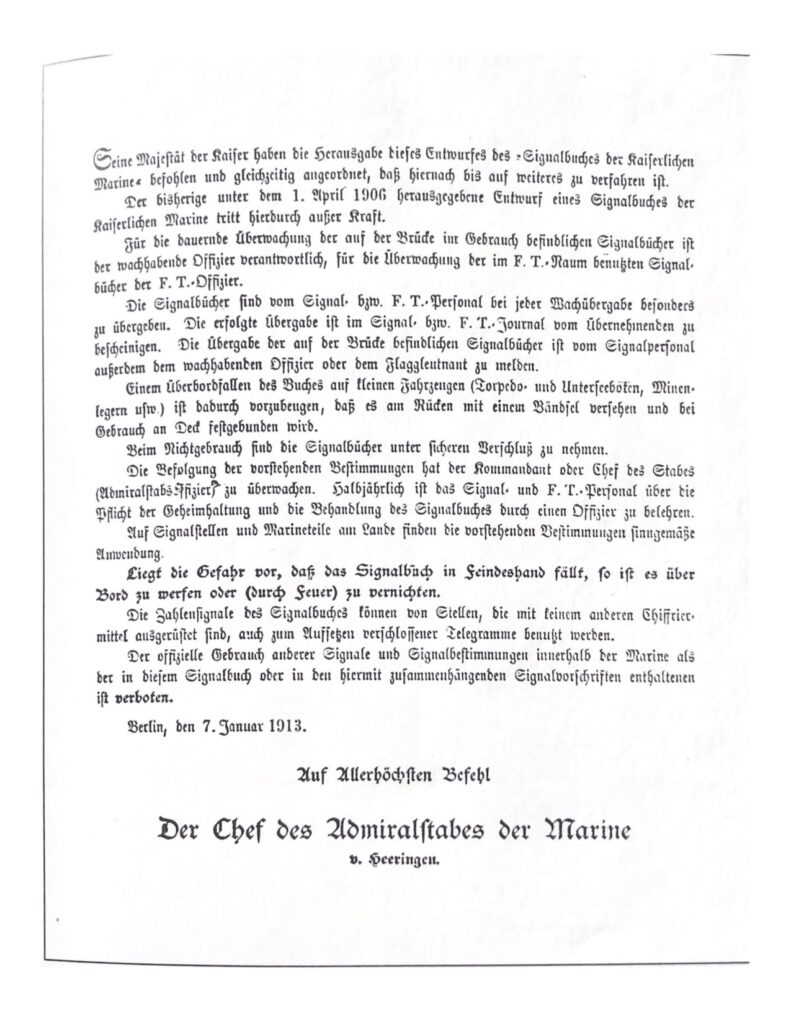
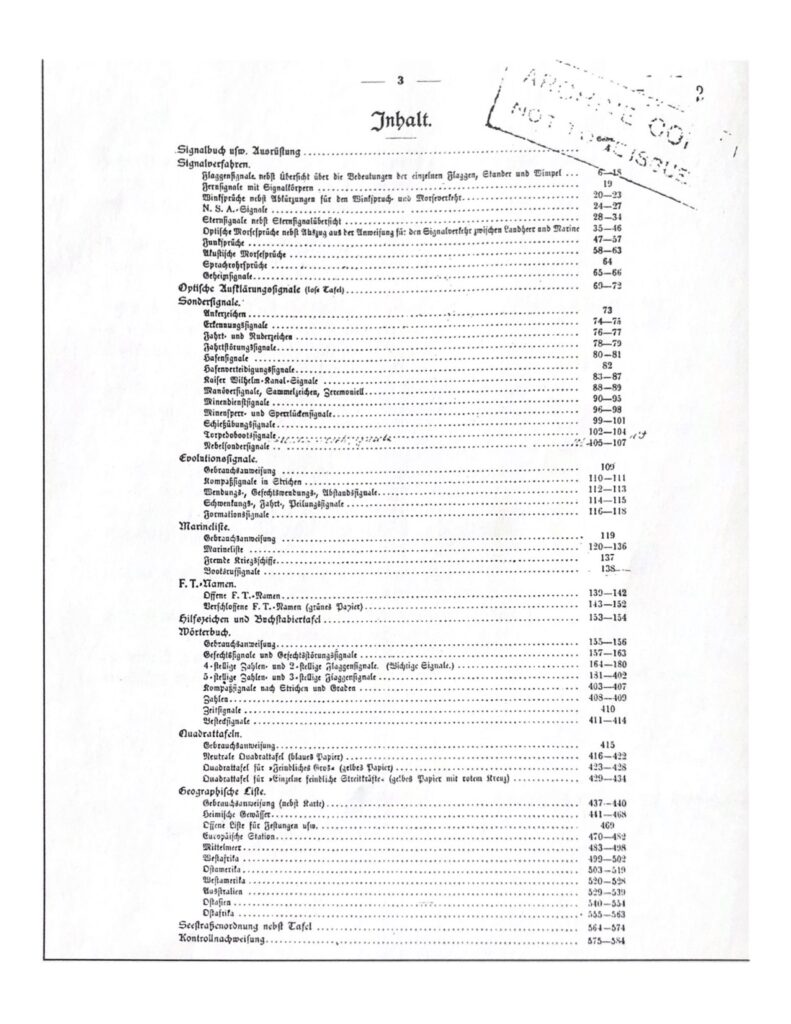
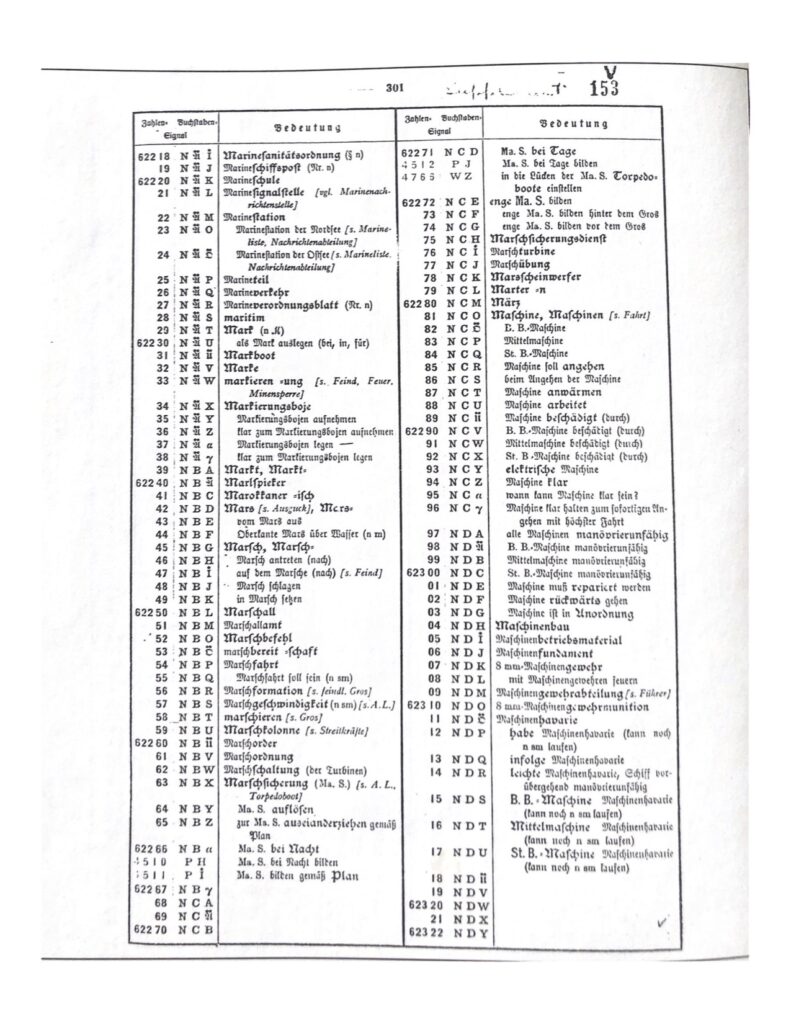
„Signalbuch der Kaiserlichen Marine“ von 1913 – Titelseite, Vorbemerkungen, Inhaltsverzeichnis und Auszug,
Bild: Quelle 23, Seite 120 — 122 und 128
Ab Kriegsausbruch, vielleicht auch schon während der vorausgegangenen Spannungstage betrieb die Kaiserliche Marine - wie offensichtlich auch die Royal Navy — nun auch „Funkaufklärung“, wozu vielleicht doch die Erkenntnisse aus der o.a. eigenen friedensmäßigen Funküberwachung der Royal Navy und die Ergebnisse der österreichisch-ungarischen Marine-Funkaufklärung beigetragen haben. Es gab allerdings zunächst noch keine zentral organisierte Marine-Funkaufklärung durch entsprechende Landstellen, sondern nur durch die Küstenfunkstelle Helgoland und von Bord der Schiffe aus — sozusagen mit „Bordmitteln“.
Die Ergebnisse dieser „Bord-Funküberwachung“ wurden zwar dezentral an Bord ausgewertet, aber nur im Sinne einer Betriebsauswertung, d.h. Umfang, Anzahl und Dringlichkeit der gegnerischen Funksprüche, Zu- oder Abnahme des gegnerischen Funkverkehrs, gegnerische Rufnamen und Frequenzen sowie Versuch der Standortfeststellung bzw. Entfernung der gegnerischen Funkstellen aufgrund der Lautstärke. Letzteres war jedoch ein höchst fragwürdiges Verfahren, da die Lautstärke nicht nur von der Entfernung, sondern u.a. auch von der Sendeleistung und den elektromagnetischen Ausbreitungsbedingungen abhängt, wodurch es in mindestens einem Fall — Verlust des Kleiner Kreuzers „Emden“ im Seegefecht mit dem überlegenen australischen Kreuzer „Sidney“ am 9. November 1914 bei den Kokos-Inseln im Indischen Ozean, mehr als 1.000 km westlich von Java bzw. Sumatra — zu verhängnisvollen Folgen kam.
Darüber hinaus wurde diese „Bord-Funküberwachung“ auch dazu genutzt, um die Wirkung eigener oder gegnerischer Störsendungen zu bewerten und ggf. die eigene Sendeleistung — soweit technisch möglich — entsprechend zu erhöhen.
Schon unmittelbar nach Kriegsbeginn kam es so Anfang August 1914 im Rahmen der Verfolgung der deutschen „Mittelmeer-Division“ — bestehend aus dem Schlachtkreuzer „Goeben“ und dem Kleinen Kreuzer „Breslau“ - durch britische Kriegsschiffe zu einem erfolgreichen Störeinsatz gegen Positionsmeldungen durch den britischen Leichten Kreuzer „Gloucester“, der Fühlung halten sollte, um ein Heranführen der übrigen britischen Kriegsschiffe zu ermöglichen und so die deutschen Schiffe abzufangen sowie zu versenken: Nachdem die Positionsmeldungen der „Gloucester“ zunächst durch die „Goeben“ nur überwacht worden waren, wurden sie ab einer für die Briten unerwarteten plötzlichen Kursänderung um 90° bei Nacht eine Stunde lang gestört, so daß es trotz mehrmaligem Frequenzwechsel der „Gloucester“ beiden deutschen Schiffen aufgrund des dadurch verursachten konfusen Lagebilds auf britischer Seite und der zeitlichen Verzögerung gelang, in die Türkei zu entkommen, wo sie auch später unter türkischer Flagge im Schwarzen Meer erfolgreiche Stör- und Täuscheinsätze gegen russische Schiffe durchführten.
Auch die „Dechiffrierstelle“ beim Kommando der Hochseeflotte (KdH) auf dessen Wohnschiff „Kaiser Wilhelm II.“ war wohl zunächst noch nicht in der Lage, gegnerische Funksprüche zu entziffern, da sich im deutschen Seekriegswerk „Der Krieg zur See 1914 — 18“ zunächst keinerlei Hinweise auf entzifferte gegnerische Funksprüche finden.
Immerhin war aber wohl die mit Funkverkehr verbundene Gefahr, durch gegnerische Funkaufklärung erfasst zu werden, nicht ganz unbekannt, da schon die ersten Operationsbefehle Anweisungen für Funkbeschränkungen enthielten, wobei ein Sendeverbot erstmals Mitte Dezember 1914 im Rahmen der deutschen Beschießungen an der britischen Ostküste angeordnet wurde.
Die Anfänge einer systematischen deutschen Marine-Funkaufklärung wurden erst ab Mai 1915 erkennbar, bei der dann im Zuge ihres über achtmonatigen Aufbaus landgestützte Marine-Funkaufklärungsstellen und neu geschaffene landgestützte Marine-Funkpeilanlagen eingesetzt wurden. Mit hierzu beigetragen hat die Erfassung von Funkverkehr der Royal Navy ab Mitte Mai 1915 durch eine Heeres-Funkstelle eines Kavallerieverbandes in Roubaix (Nord-Frankreich; nahe der belgischen Grenze) im Bereich des Armeeoberkommandos 6, der über das Große Hauptquartier an den Admiralstab weitergeleitet und zu dessen weiterer fachlicher, inhaltlicher Auswertung dort ein Marineoffizier angefordert wurde. Dieser traf im Juli 1915 ein, später folgten auch Marinefunker und schließlich wurde die dortige Funkstelle völlig von der Marine übernommen und verlegte dann nach Brügge/Brugge/Bruges (Westflandern in Belgien), was für Marinezwecke günstiger gelegen war, um danach im Zuge der inzwischen auch nach Norden ausgeweiteten Marine-Funkaufklärungsbereiche um Scapa Flow, nördliche Nordsee und Shetland-Enge bis Anfang Februar 1916 mit Teilen nach Neumünster zu verlegen, wo die neue „Beobachtungs- und Entzifferungs-Hauptstelle“ („B- u. E‑Hpt-Stelle“) der Kaiserlichen Marine aufgestellt und aufgebaut wurde — dies war die eigentliche „Geburtsstunde“ der deutschen Marine-Funkaufklärung.
Bei dieser teilweisen Verlegung nach Neumünster blieb in Brügge eine „B- u. E‑Stelle“ bestehen, die dem dort an der Westfront infanteristisch eingesetzten deutschen Marinekorps unterstellt wurde und an dieses sowie an die U‑Bootflottille in Flandern ihre Funkaufklärungsergebnisse aus dem Ärmelkanal und entlang der südlichen Ostküste von Großbritannien meldete. Die „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster — unterstützt durch eine „B‑Stelle“ in Tondern/Tönder (Nordschleswig im heutigen Süd-Dänemark) für die Marine-Funkaufklärung der britischen Hochseeflotte und an der nördlichen Ostküste von Großbritannien — meldete an Admiralstab sowie Kommando der Hochseeflotte. Der Ostsee-Kriegführung diente die „B- u. E‑Stelle“ in Libau/Liepaja (Kurland im heutigen Lettland; nur bis Ende 1917) und für die Marine-Funkaufklärung im östlichen Mittelmeer wurden in Skopje (damals Üsküb in Mazedonien) sowie für das mittlere und westliche Mittelmeer auf dem Dampfer „Wien“ in Pola/Pula (Istrien/Kroatien) drei weitere „B- u. E‑Stellen“ zur Unterstützung des U‑Bootkriegs im Mittelmeer eingerichtet, wobei es nicht bei der Aufklärung von britischem Marine-Funkverkehr blieb, sondern auch der französische, russische und dänische sowie schwedische, im weiteren Verlauf des I. Weltkriegs auch der italienische und US-amerikanische Marine-Funkverkehr einbezogen wurden.

„Beobachtungs- und Entzifferungsstellen“ der Kaiserlichen Marine in West-Flandern, Nord-Schleswig, Schleswig-Holstein und Kurland,
Graphik: Quelle 23, Seite 73
O.a. Erfassung von Funkverkehr der Royal Navy ab Mitte Mai 1915 durch eine Heeres-Funkstelle eines Kavallerieverbandes in Roubaix führte außerdem dazu, daß am 18. Mai 1915 erstmals ein — allerdings wohl unverschlüsselter - Funkspruch der Royal Navy dem in See befindlichen Chef der deutschen Hochseeflotte übermittelt werden konnte.
Erst am 27. Februar 1916 war dann die inzwischen aufgestellte „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster in der Lage, erstmals den Inhalt eines mit Sicherheit entzifferten Funkspruchs der Royal Navy an das KdH zu melden, dessen ganze Tragweite und Bedeutung allerdings wahrscheinlich noch nicht erkannt wurde, denn die Information wurde nicht an den betroffenen Hilfskreuzer „Greif“ weitergeleitet, welcher in der Folge durch britische Kreuzer versenkt wurde. Es bedurfte erst weiterer entzifferter Funksprüche, um im Stab des KdH durch Auswertung die Verläßlichkeit dieser neuen Quelle von Feindlageinformationen zu erkennen und daraufhin Maßnahmen einzuleiten.
In der Skagerak-Schlacht zwischen der deutschen Hochseeflotte und der britischen „Grand Fleet“ am 31. Mai/1. Juni 1916 ging am frühen Morgen des 31. Mai mit nur 40 Minuten Laufzeit eine sehr wichtige Meldung der „B- u. E‑Hpt-Stelle“ auf dem Flaggschiff der deutschen Hochseeflotte ein, daß zwei große britische Kriegsschiffe oder Flottenverbände mit Zerstörern aus Scapa Flow ausgelaufen seien. Eine zweite Meldung gegen Mittag besagte, daß die erfasste britische Wettermeldung für den Firth of Forth bisher nur bei Inseesein eines Flottenverbandes festgestellt worden waren — im Firth of Forth lagen die britische Schlachtkreuzerflotte, so daß der Chef der deutschen Hochseeflotte nunmehr von deren Auslaufen und Teilen der in Scapa Flow liegenden Grand Fleet ausgehen konnte. Während der Skagerak-Schlacht gelang es der deutschen Marine-Funkaufklärung dagegen nicht, die verschlüsselten Funksprüche der britischen Grand Fleet zu entziffern — dies geschah erst im Nachgang dazu. Erst am Morgen und Vormittag des 1. Juni ging aus entzifferten und an das KdH übermittelten Funksprüchen der Grand Fleet hervor, daß die britische Schlachtkreuzerflotte kehrtmachen sollte, wenn bis 09:30 Uhr nichts gesichtet sei und daß die Grand Fleet mit 20 sm/Std auf Nordkurs war, also den Rückmarsch angetreten hatte.
Auch der deutsche Marine-Funkverkehr bewährte sich in der Skagerak-Schlacht — im Gegensatz zum britischen — erstmals auch im großen Rahmen — der I. Weltkrieg hatte seine technische Entwicklung und seine Anwendung auf taktisch-operativer Ebene beschleunigt, so daß die „Funkentelegraphie“ zum wichtigsten deutschen Mittel der Nachrichtenübertragung auf See geworden war, wenn auch optische Signalmittel weiterhin eingesetzt wurden.
Um die im Rahmen der U‑Boot-Kriegführung immer größer werdenden Entfernungen mit Funk zu überbrücken, setzte man inzwischen erfolgreich getestete Langwellenverbindungen zwischen 167 und 250 kHz über die Maschinensender der Funkstation Nauen westlich von Berlin ein, die insbesondere nachts über Seewasser noch in bis zu ca. 5.000 Kilometer Entfernung empfangen werden konnten.
Insgesamt ist jedoch festzustellen, daß in der Kaiserlichen Marine die Flottenführung die Bedeutung der „Funkentelegraphie“ als neues Führungsmittel für die Einsatzführung von Schiffen und Booten in See- trotz der schnellen Einführung von Funkentelegraphiegeräten auf allen seegehenden Einheiten — in ihrer vollen Tragweite nicht erkannt hat, da zwar ihre Entwicklung und Einrüstung gefördert wurden, aber man sich mit den dazugehörigen Funktionsabläufen („Prozessen“) und der Integration dieses neuen Führungsmittels in den Führungsprozeß der Marine noch nicht beschäftigt hatte.
Die deutsche Marine-Funkaufklärung hat dafür, daß sie überhaupt erst seit Sommer 1915 bestand, insgesamt erfolgreich gearbeitet und die Führungsstellen der Kaiserlichen Marine fortlaufend mit wertvollen Feindlageinformationen versorgt, von deren Verläßlichkeit sich diese allerdings erst überzeugen lassen mußten: Nachteilig war dabei u.a. die räumliche Trennung zwischen der „B- u. E‑Hpt-Stelle“ in Neumünster und dem KdH in Wilhelmshaven gewesen.
Mit den bei Ende des I. Weltkriegs vorhandenen Röhrensendern und ‑empfängern verfügte auch die stark verkleinerte Reichsmarine ab 1919 über moderne und angemessene Funktechnik, die in den Folgejahren fortlaufend modernisiert wurde — z.B. wurde 1927 in Kiel-Holtenau/Friedrichsort die damals modernste deutsche Küstenfunkstelle mit 5- und 3‑kW-Sendern im Kurzwellenbereich (5 — 25 MHz) und einem 800-kW-Langwellensender eingerichtet.
Im Zuge des Wiederaufbaus und Vergrößerung zur Kriegsmarine in den 1930-er Jahren wurden Einheitsbordfunkstellen in ihre Schiffe eingebaut, auf ihren Schlachtschiffen sowie ‑kreuzern entstanden Nachrichtenzentralen und auf ihren kleineren seegehenden Einheiten — u.a. auch auf Landungsbooten sowie Hilfskreuzern — wurden kombinierte Lang- und Kurzwellen-Funkanlagen eingerichtet. Für die Verbindungen innerhalb eines Marineverbandes wurde Sprechfunkbetrieb über neu entwickelte UKW-Funkgeräte eingeführt, so daß alle ihre Schiffe und Boote auf dem neuesten funktechnischen Stand waren.
Aus Sicherheitsgründen wurde für den Kriegsfall das „Blindfunkverfahren“ festgelegt, bei dem Funksprüche zu genau festgelegten Zeiten mehrmalig ohne Empfangsbestätigung abgesetzt wurden, welches sich im II. Weltkrieg bis zu seinem Ende bewährte.
Durch Aufteilung der Befehlsstände und ihrer Ausstattung mit Nachrichtenmitteln wurde die Führungsfähigkeit der Kriegsmarine verbessert bzw. sichergestellt — so verfügte z.B. die Seekriegsleitung mit den Marinekommandos Ost- und Nordsee über verbunkerte Befehlsstellen in Mistroy und Sengwarden.
Die Erfahrungen aus dem I. Weltkrieg bei der U‑Boot-Kriegführung über sehr weite Entfernungen setzte man ab 1935 bei Planung und ab 1941 durch Bau des ferntastbaren 1‑MW-Längstwellen-Senders „Goliath“ (15 — 60 kHz) bei Calbe an der Milde (seit 1951: Kalbe an der Milde) in der Altmark um, der die bisherigen Längstwellensender in Nauen ersetzte und mit dem auf seiner Hauptfrequenz von 16,53 KHz ab 1943 U‑Boote weltweit auch in bis zu ca. 25 m Tiefe, mindestens aber auf Sehrohrtiefe (= 14,5 m bei U‑Boot-Typ VII) erreicht werden konnten.

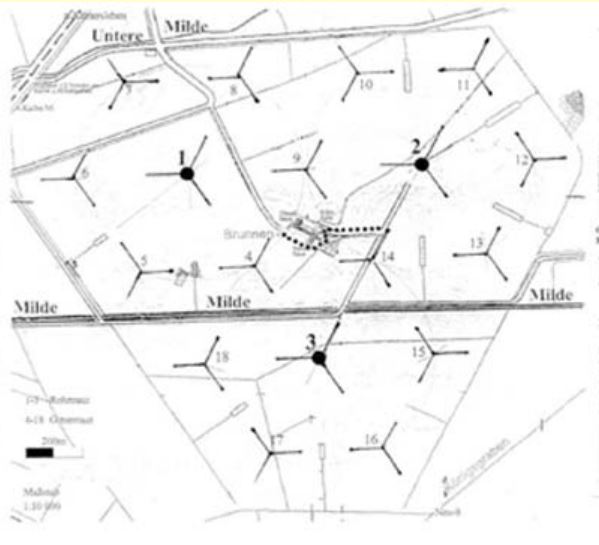
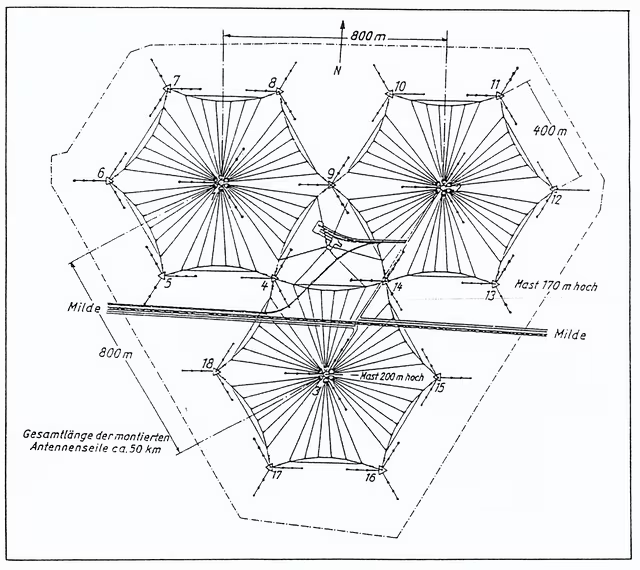
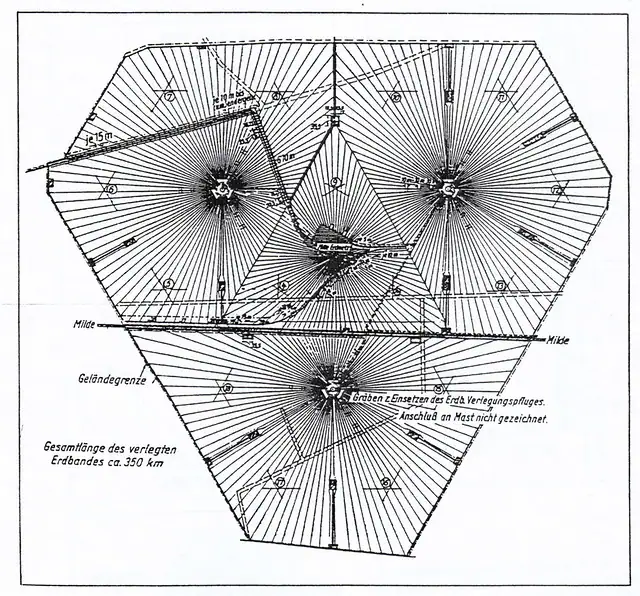


Längstwellen-Sender „Goliath“ — Lage des Antennenfelds bei Kalbe („Sechseck“ nordostwärts von Kalbe), Antennenfeld,
Antennenschema und Erdnetz bei Calbe
● – Zentraler Rohrmast (210 m)
Δ – Stahlfachwerkmast (170 m)
sowie Sendebetriebsgebäude in der Mitte des Antennenfelds und Antennen am heutigen Standort bei Nischni Nowgorod ca. 400 km ostwärts von Moskau,
Bilder und Graphiken: https://de.wikipedia.org/wiki/Goliath_(Funk) und www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/verlauf/laengstwellensender-goliath-u-boot-kalbe-milde-altmark-russland-100.html
1934 wurde in einer Studie über u.a. den „Funkbeobachtungsdienst“ (= Funkaufklärung) der Kaiserlichen Marine ihr angeblich „sehr dürftiges“ Gesamtergebnis im I. Weltkrieg (siehe oben: !?) veröffentlicht, wobei auch die fehlende Eingliederung des (Marine-)Nachrichtendienstes in den Admiralstab und die geringe Sicherheit der deutschen (Marine-)Funkverfahren bemängelt wurden. Nachdem die Reichsmarine bereits 1926 eine modifizierte Version der kommerziellen elektromechanischen Schlüsselmaschine ENIGMA‑C eingeführt hatte, war eine Folge dieser Studie nun die Einführung einer verbesserten ENIGMA‑M ab 1934 auch bei der Kriegsmarine (zunächst ENIGMA-M1, die nahezu baugleich als ENIGMA I bereits ab 1930 beim Reichsheer genutzt wurde; ab 1938 ENIGMA-M2, ab 1940 ENIGMA-M3 und ab 1941 ENIGMA-M4), welche jedoch bei weitem nicht so sicher war, wie man in der Kriegsmarine bis zum Ende des II. Weltkriegs glaubte und wie auch noch bis in die 1970-er Jahre von deutscher Seite behauptet wurde, bis dann die britischen „ULTRA-Veröffentlichungen“ das Gegenteil bewiesen.

ENIGMA-M4,
Bild: Wikipedia
Dagegen wurde das Marine-Nachrichtenwesen lange nicht als Funktion und Bestandteil der Führung in der Kriegsmarine erkannt — erst 1941 wurde es zentral in der Führung des Marinenachrichtendienstes im Oberkommando der Marine zusammengefaßt und in der Seekriegsleitung dem Marinenachrichtendienst unterstellt: Erst im Laufe des II. Weltkrieges sollte es eine Gliederung finden, die seiner Bedeutung für die Seekriegsführung gerecht wurde.
Dies betrifft auch die Marine-Funkaufklärung, deren Tätigkeit bei Kriegsende 1918 eingestellt worden war und deren „B- u. E‑Stellen“ sämtlich aufgelöst worden waren: Aber bereits Ende April 1919 hatte wieder eine „Zentralstelle für den Beobachtungs- und Entzifferungsdienst“ ihre Arbeit diesmal in Berlin am Sitz der Marineleitung aufgenommen — allerdings mit zunächst nur neun Mitarbeitern. Ab Herbst 1929 war sie dann jedoch für mindestens drei Jahre nach Kiel verlegt worden, um die Ministerialzulage einzusparen (!), kehrte aber spätestens Ende 1933 nach Berlin zurück und wurde als selbständiges Dezernat, später Gruppe „Funkaufklärung“ mit einer friedensmäßigen Personal-Sollstärke von 110 in die Marine-Nachrichten-Abteilung der Marineleitung - später in der Abteilung „Marine-Nachrichtendienst“ in der Seekriegsleitung — eingegliedert, verfügte aber 1936 erst über eine Ist-Stärke von ca. 30 und hatte selbst bis zum Beginn des II. Weltkriegs in 1939 ihre o.a. Soll-Stärke noch bei weitem nicht erreicht.
Als 1920 die Marine-Funkaufklärung wieder in größerem Umfang aufgenommen werden sollte, standen hierfür zunächst die vielen, aufgrund der nur sehr kleinen deutschen Seestreitkräfte relativ „beschäftigungslosen“ Küstenfunkstellen in Borkum, Wilhelmshaven, Nordholz und List an der Nordsee sowie Falshöft, Neumünster, Kiel, Arkona, Swinemünde, Stolpmünde und Pillau für die Ostsee zur Verfügung, wobei deren geographische Lage allerdings — insbesondere für Funkpeilungen/-ortungen — eher ungünstig war. Deshalb wurde 1925 eine nun sogenannte Marine-Funkstelle in Villingen/Schwarzwald eingerichtet, aufgrund ungünstigerer Empfangsbedingungen als erwartet jedoch 1926 nach Landsberg/Lech verlegt, um 1936/37 ihren endgültigen Standort in Langenargen am Bodensee zu finden.
Neben einer weiteren Marine-Funkstelle in Soest ab 1936 zur Verbesserung der Funkpeilmöglichkeiten nach Westen wurde nach der Okkupation von Österreich ab 1938 eine dritte Marine-Funkstelle im Inland in Neusiedl am See eingerichtet.
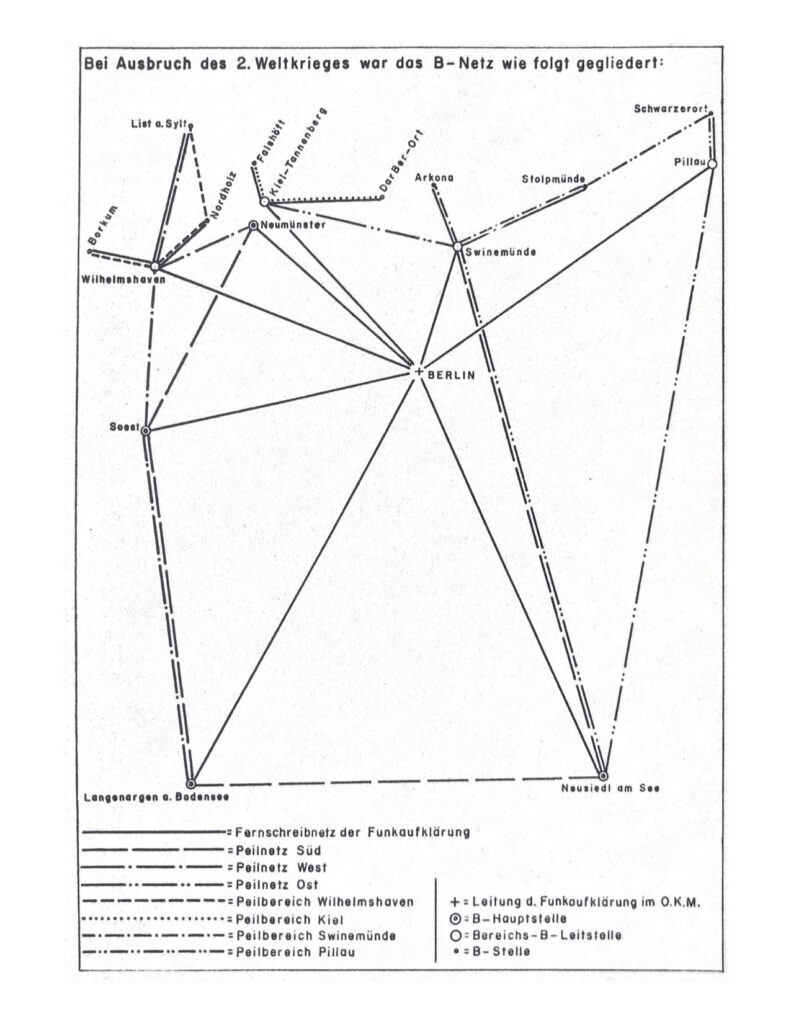
Bild 21: Marine-Funkaufklärungsnetz zu Beginn des II. Weltkriegs,
Graphik: Quelle 10, Seite 80
In den Jahren bis zum Beginn des II. Weltkriegs wurden durch dieses „Netz“ der deutschen Marine-Funkaufklärung vor allem der Routine-Funkbetrieb, aber auch der Funkbetrieb bei allen größeren Manövern insbesondere der britischen, französischen und russischen Marine erfasst und ausgewertet, so daß bedeutsame Rückschlüsse auf deren Funkverfahren sowie Ausbildungsstand, operative Absichten und taktische Führung möglich waren.
Aufgrund der gemäß Versailler Vertrag nach dem I. Weltkrieg verbotenen deutschen Luftstreitkräfte entfiel auch die Notwendigkeit einer „Fliegerfunktruppe“ und Angelegenheiten des Flugfunks (Boden-Bord-Funkverbindungen sowie Flugnavigation und ‑sicherung) wurden durch die Heeresnachrichtentruppe offiziell nicht bearbeitet, inoffiziell aber wurden durchaus Maßnahmen zum Wiederaufbau einer „Fliegerfunktruppe“, u.a. durch Ausbildung von Bordfunkern im sowjetischen Ausbildungszentrum Lipezk im Rahmen der geheimen Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee sowie durch getarnte Entwicklung von Flugfunkgeräten bei der deutschen Luftfahrtindustrie, eingeleitet.
Nach Wiedererlangung der (zivilen) „Lufthoheit“ im Jahr 1926 sowie Wiederaufnahme des zivilen Luftverkehrs in Deutschland wurde zunehmend seine Überwachung und Steuerung aktuell, was 1927 zum Aufbau einer Zentralstelle für Flugsicherung im Reichsministerium für Verkehr führte, die u.a. für den Boden-Bord-Funkverkehr zur Übermittlung von Standort- und Wettermeldungen, den Flugpeildienst sowieLandefunkverfahren für Verkehrsflughäfen bei schlechtem Wetter zuständig wurde, wobei sich eine Reihe von Überschneidungen mit entsprechenden militärischen Aufgaben und Regelungen abzeichneten.
Im Rahmen der Ernennung von Hermann Göring zum Reichskommissar für Luftfahrt im Februar 1933 wurde die Zentralstelle für Flugsicherung in Reichsamt für Flugsicherung umbenannt und diesem unterstellt sowie im November 1934 in Reichsamt für Wetterdienst umgegliedert und die Flugsicherung in das inzwischen gebildete Reichsluftfahrtministeriums (RLM) ausgegliedert, wo ihre Leitung beim Amt für zivile Luftfahrt lag.
Im RLM war bereits seit Ende April 1933 unter Leitung von Major, ab 1934 Oberstleutnant Wolfgang Martini4 zunächst als „Luft-Nachrichtenverbindungs-Offizier“, später als Leiter der Abteilung „Nachrichtenverbindungswesen“ (NVW) mit dem zunächst noch geheimen Wiederaufbau einer „Fliegerfunktruppe“ für Bordfunkverbindungen sowie militärische Flugsicherung begonnen worden, die zunächst noch durch Uniformen des Deutschen Luftsport-Verbandes (DLV) bzw. der „DLV-Fliegerschaft“5 getarnt war, welche jedoch 1935 mit geringfügigen Änderungen in Form von militärischen Dienstgradabzeichen durch die Luftwaffe übernommen wurden.
Ab 1934 wurde im Zusammenhang mit dem zunächst noch verdeckten Aufbau der Luftwaffe und unter Abstützung auf das Fern-Leitungsnetz der DRP begonnen, ein Luftwaffen-Grundnetz und mehrere ‑Sonder-Nachrichtennetze in Form von raumdeckenden Gitternetzen mit Vermittlungen aufzubauen, die alle über 200 Fliegerhorste, Stäbe, Kommandobehörden und sonstigen Dienststellen der Luftwaffe im 24-Std-Dauerbetrieb über luftwaffeneigene Nachrichtenverbindungen erreichbar machen sollten. Darüber hinaus begann 1934 auch das Herstellen von Flieger-Funkverbindungen für Boden-/Boden‑, Boden-/Bord- und Bord-/Boden-Verbindungen, Flugsicherungsverbindungen sowie Flugmeldeverbindungen – zur militärischen Flugsicherung wurden außerdem durch die „Fliegerfunktruppe“ auch Langwellen-„Funkfeuer“ für Funklandeverfahren, Funkpeilstellen und Wetter-Funkstellen auf den Fliegerhorsten eingerichtet und betrieben.
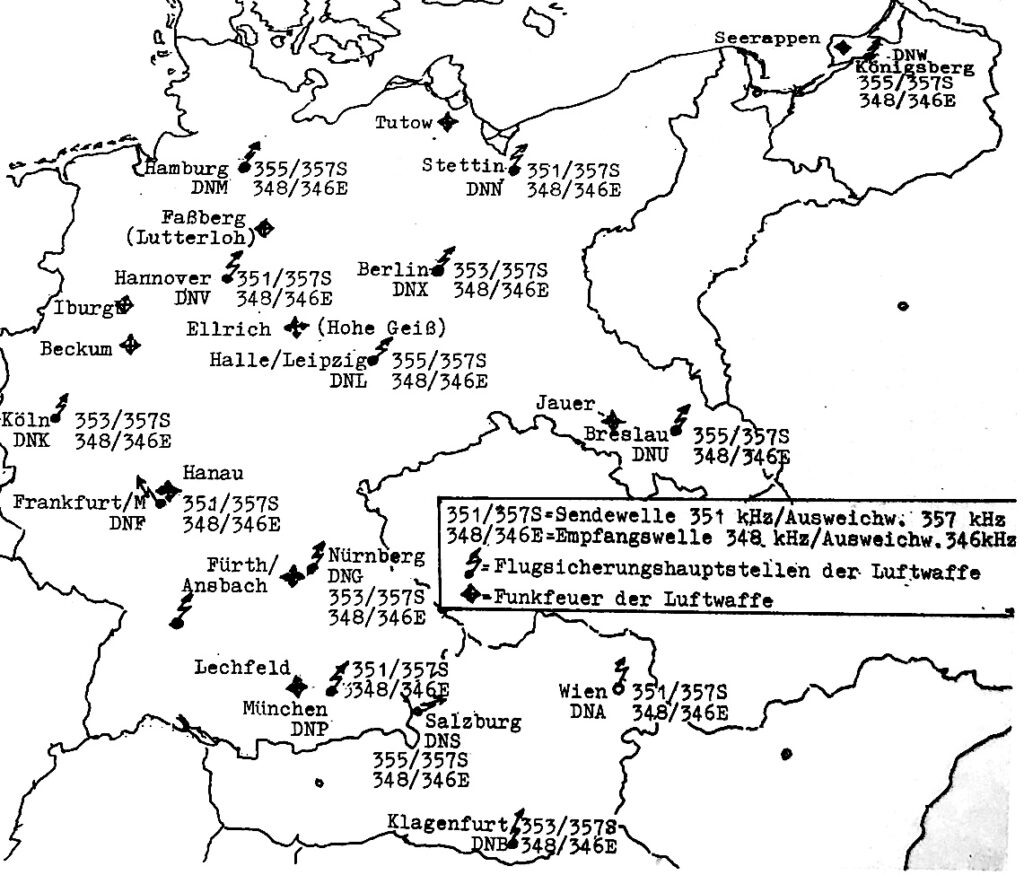
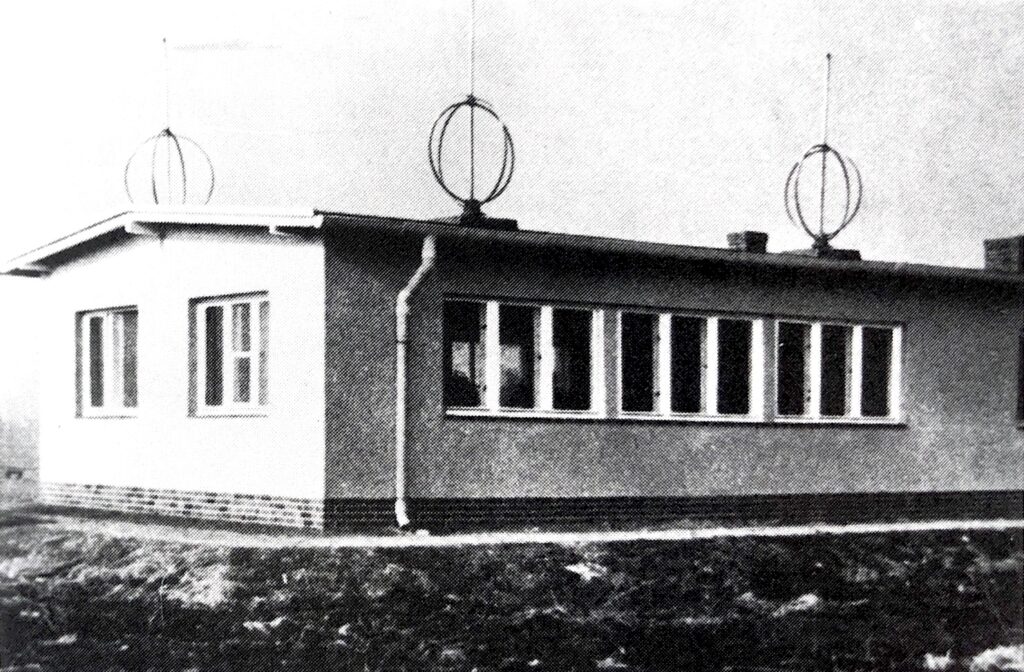
Bild: Quelle 27, Seite 65
Ab der offiziellen Bekanntgabe der Bildung einer deutschen Luftwaffe im März 1935 wurde die bisherige „Fliegerfunktruppe“ als Luftnachrichtentruppe (LnTr) bezeichnet und bildete neben der Fliegertruppe und der Flakartillerie die dritte Truppengattung der Luftwaffe außer den Luftwaffen-Erdkampfverbänden (u.a. Fallschirmjägertruppe und Luftwaffen-Felddivisionen). Den Stamm ihres Offizierskorps bildeten dabei 15 aktive Offiziere der Heeresnachrichtentruppe, die zur Luftwaffe wechselten.
Auf regionaler Ebene der „Luftkreise“ bzw. der späteren „Luftgaue“ (analog zu den „Wehrkreisen“ des Heeres) wurden anfangs LnKp für Fernsprech‑, Fernschreib- und Funkbetrieb sowie für Funkhorchdienst, zum Ausbau von NachrVbdg und zur Flugsicherung auf den zugehörigen Fliegerhorsten aufgestellt, die später zu LnAbt und schließlich zu LnRgt ausgebaut wurden, wobei ihre grundsätzlichen Aufgaben dieselben blieben.
Auf örtlicher Ebene der 204 Fliegerhorste wurden in 1934 bei den fliegenden Verbänden zunächst„Flieger-Nachr-Stellen“ eingerichtet, die ab 1935 als Ln-Stellen bezeichnet wurden und welche die örtlichen Fernsprechvermittlungen, Fernschreib‑, Funk- sowie Funkpeilstellen und Wetter-Funkstellen umfassten.
Außerdem wurde ab 1935/36 unter der Tarnbezeichnung „Wetterfunk-Empfangsstellen“ bei den LnRgt - ab Sommer 1939 mit zwei Funkhorchkompanien in der III. Abteilung - ein Luftwaffen-Funkhorchdienst aufgebaut, der ab Anfang Januar 1937 zentral durch die Chiffrierstelle des Oberkommandos der Luftwaffe6 gesteuert wurde und der im Laufe des II.Weltkriegs auf eine Personalstärke von nahezu 13.000 aufwuchs — eine erste Funkhorchstelle der LnTr wurde dabei 1936 in München eingerichtet.
Eine LnAbt mit vier Kompanien wurde im Rahmen der „Legion Condor“ in Spanien (1936 — 1939) eingesetzt, wobei wichtige Erfahrungen für Organisation, Ausrüstung (siehe Post 17) und Einsatz gesammelt werden konnten.
1937 wurden spezielle Ln-Verbindungstrupps zum Heer aufgestellt, die als Fliegerleittrupps eingesetzt werden sollten, und es wurden feste Richtfunk-Versuchsverbindungen der Luftwaffe eingerichtet sowie eine erste Richtfunkverbindungskompanie der Luftwaffe aufgebaut.
1938 wurde auch noch der Flugmeldedienst in die LnTr eingegliedert, welche 1939 mit Beginn des II. Weltkriegs noch um Funkführungsdienst, Funkmeß- und Jägerleit-Dienst sowie Funkmeß-Beobachtung/-Aufklärung, ‑Störung und ‑Täuschung erweitert wurde, deren Systeme zu diesem Zeitpunkt den entsprechenden britischen bzw. denen für Elektronische Gegenmaßnahmen zunächst noch überlegen waren.
Der Funkführungsdienst der LnTr betrieb vor allem bis zum Beginn des Rußlandfeldzugs Ende Juni 1941, als die deutschen Bomberverbände an die Ostfront verlegt wurden, ein System von verschiedenen Funkleitstrahlen bzw. Funkführungsverfahren („X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“, „Knickebein“, „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“, „EGON-Verfahren“ und „Peilruf-Verfahren“), die dem Zielanflug für deutsche Nachtbomber in Großbritannien dienten.
Das 1938 eingeführte „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ mit vier Leitstrahlen (0,1°; 66 — 77 MHz) und einer Reichweite von bis zu 350 km bei einer 50%-igen Zielgenauigkeit von ± 300m war dabei aus dem bereits seit 1932/33 vorhandenen Lorenz-Navigationssystem zum Blind-Landeanflug bei Nacht oder schlechter Sicht („Lorenz-Bake“) weiterentwickelt worden, worauf die Briten mit Elektronischen Täuschmaßnahmen durch „masking beacons“ („meacons“) reagierten, was zu deutschen Gegenmaßnahmen mittels „Kreuzstrahlen“ größerer Genauigkeit (britische Bezeichnung: „Headache“) führte, die britischerseits wiederum Elektronische Täuschmaßnahmen durch Verstärkung eines der beiden deutschen Leitstrahlen (britische Bezeichnung: „Bromide“) auslösten — wodurch es zum Beginn der sogenannten „Battle of the Beams“ kam. Aufgrund der vier Leitstrahlen war ein zusätzliches „X‑Gerät“ an Bord der Flugzeuge und eine aufwendige Einweisung der Bediener erforderlich, so daß es nur im Kampfgeschwader 100 genutzt wurde, dessen Flugzeuge dann als „Pfadfinder“ für die nachfolgenden Bomber der anderen Geschwader dienten.
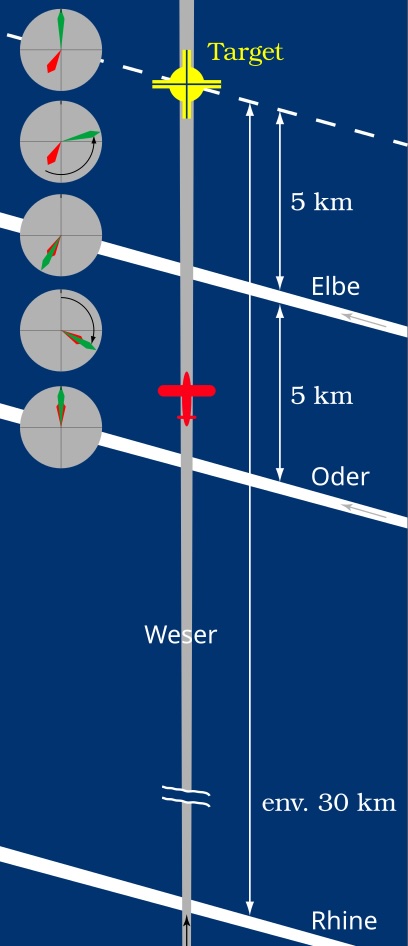
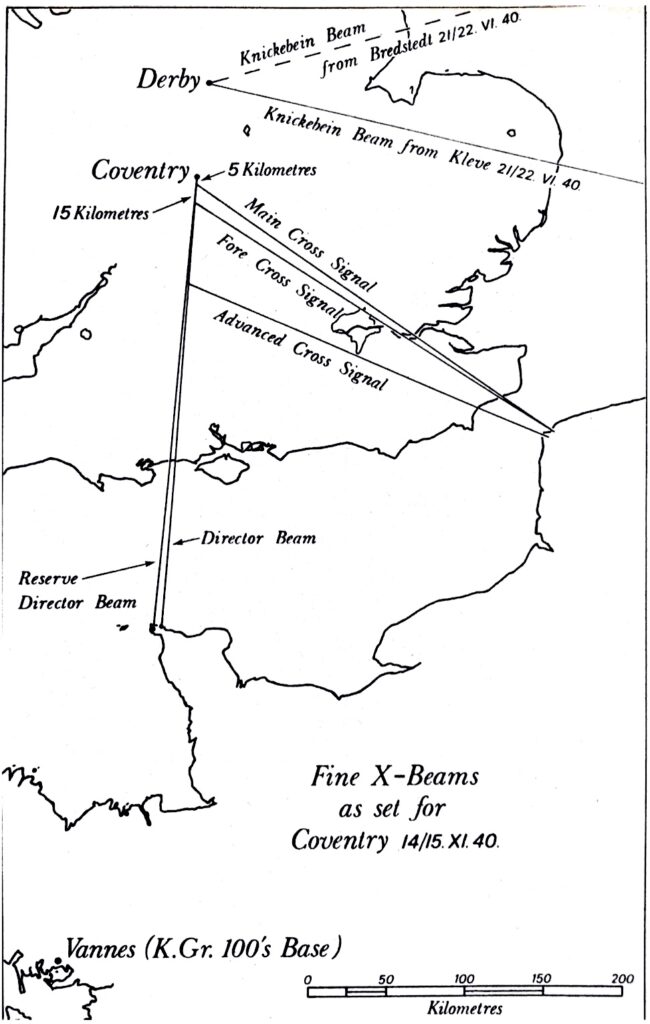
Prinzipskizze zu „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“,
Graphik: Wikipedia, „X‑Strahlen“ beim Bombenangriff auf Coventry am 14./15.11.1940,
Graphik: Quelle 17, Seite 236
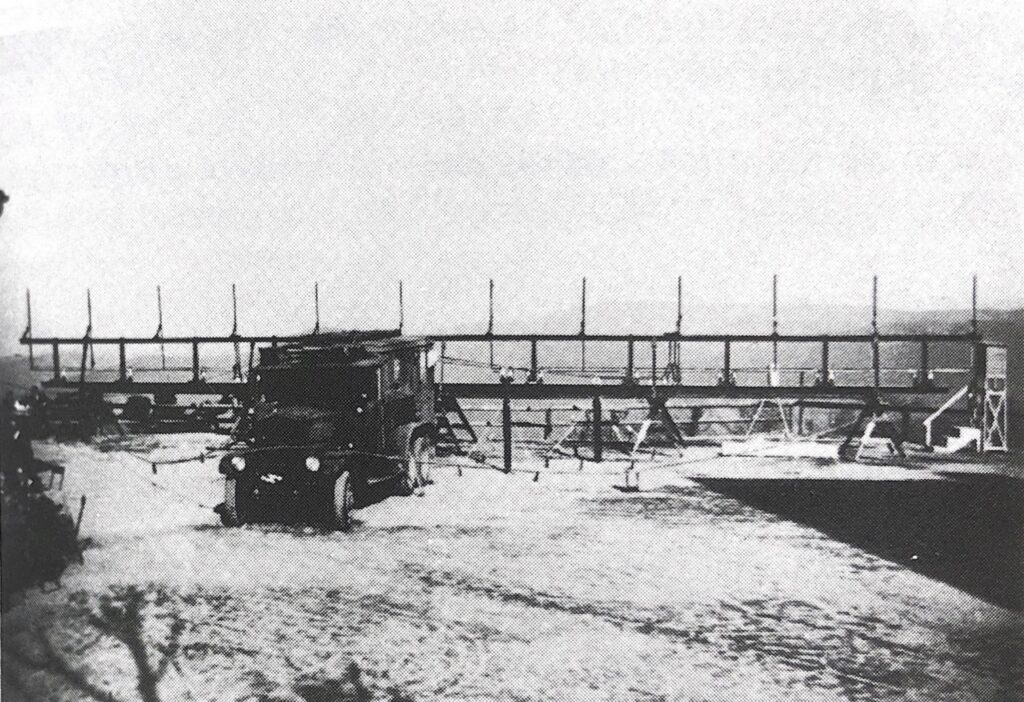
Mobile „X“-Leitstrahlbake, Bild: Quelle 27, Seite 11
„Knickebein“ war ab 1939 ein gegenüber dem „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ vereinfachtes Funkführungsverfahren mit nur zwei Leitstrahlen (30–33 MHz) und einer Reichweite von bis zu 500 km, das zudem ohne das „X‑Gerät“ auskam, da es das sowieso vorhandene Lorenz-Blindlandeanflug-Gerät nutzte, war allerdings deutlich ungenauer als das „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“: Einzelne Flächenziele konnten in einer Entfernung von 250 km in einem Zielkreis von ± 1.500 m mit ausreichender Genauigkeit getroffen werden. Aufgrund von auch hiergegen durchgeführten britischen Elektronischen Gegenmaßnahmen („Aspirin“) wurde durch häufigen Frequenzwechsel und schlagartige Einschaltung mehrerer „Knickebein“-Anlagen versucht, diesen Gegenmaßnahmen zu entgehen — bald aber wurde „Knickebein“ nur noch für den Einflug in den britischen Luftraum, jedoch nicht mehr für den Zielanflug genutzt.
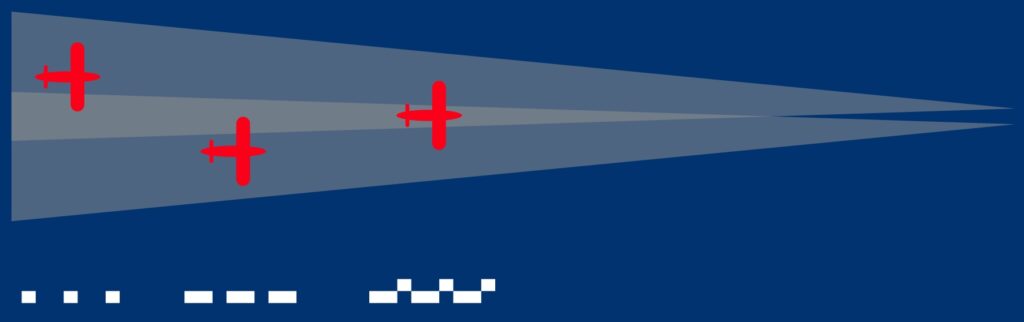
Grafik: Wikipedia

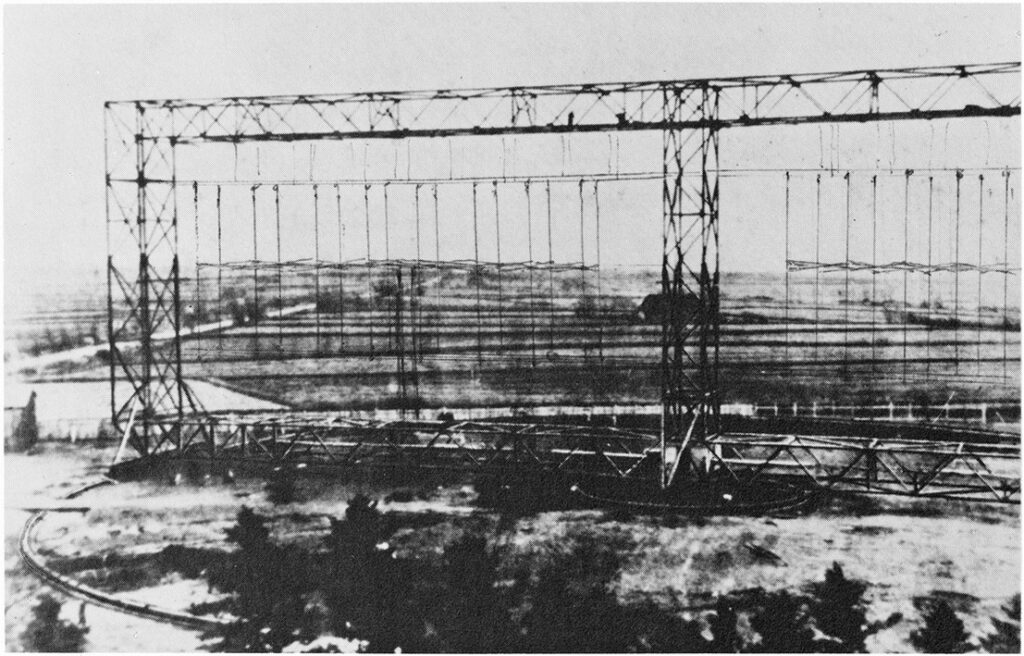

„Knickebein“-Antennen,
Bilder: Quelle 27, Seite 129 und sowie BArch-MA
Das „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ ab Anfang Oktober 1940 mit einer Reichweite von bis zu 350 km kam mit nur einem Leitstrahl (42 — 48 MHz) aus und benutzte zusätzlich eine elektronische Entfernungsmessung, wodurch es genauer als das „X‑Verfahren“ bzw. „WOTAN I“ war, konnte aber nur von bis zu fünf Flugzeugen gleichzeitig genutzt werden. Auch gegen das „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ wurden britische Störsender („Domino“ und „Benjamin“) entwickelt und eingesetzt, mit denen ab Mitte Februar 1941 die elektronische Entfernungsmessung gestört bzw. verfälscht („Domino“) bzw. ab Ende Mai 1941 der Leitstrahl verfälscht („Benjamin“) werden konnten, so daß die Luftwaffe ihr Vertrauen in das System verlor.
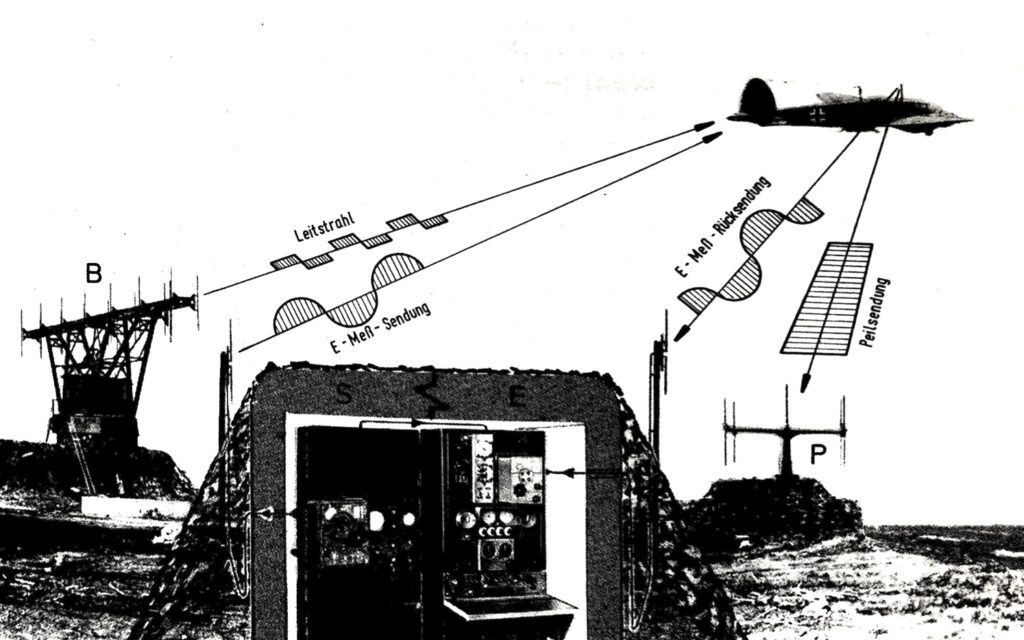
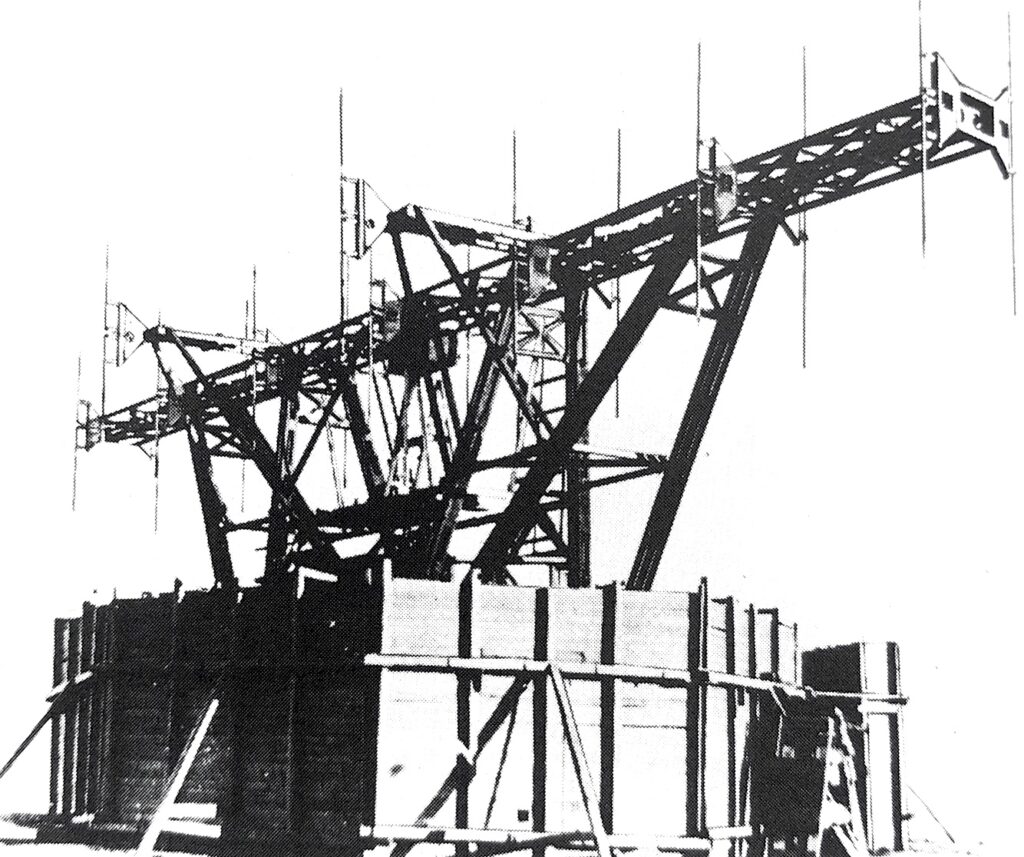
Prinzipdarstellung zu „Y‑Verfahren“ bzw. „WOTAN II“ und Y‑Zweistrahlbake,
Bilder: Quelle 27, Seite 139 und 142
Bei den späteren deutschen Bombenangriffen in Großbritannien im Jahr 1943 und 1944 wurde dann das bis dahin zunächst zur Jägerleitung entwickelte, kaum störbare „EGON-Verfahren“ (EGON = „Erstling“-„Gemse“-Offensiv-Navigation) mit einer Reichweite von bis zu 250 km auch durch deutsche „Pfad-/Zielfinder“- sowie Markierungs- und Beleuchterflugzeuge genutzt, bei dem deren sogenannte „Erstling“-Funkgeräte (FuG 25a) durch modifizierte FREYA-Radargeräte mit einem „Q‑Gerät“ („Kuh“) auf 125 MHz abgefragt wurden, woraufhin diese nach heutigen Begriffen „Transponder“ auf 156 MHz eine Kennung zu dem Kennungsempfänger „Gemse“ der modifizierten FREYA-Radargeräte — nach heutigen Begriffen ein „Sekundär-Radar“ — abstrahlten. Aufgrund der so ermittelten Flugzeugposition wurden dann ggf. Kurskorrekturen mittels UKW-Sprechfunk übermittelt.
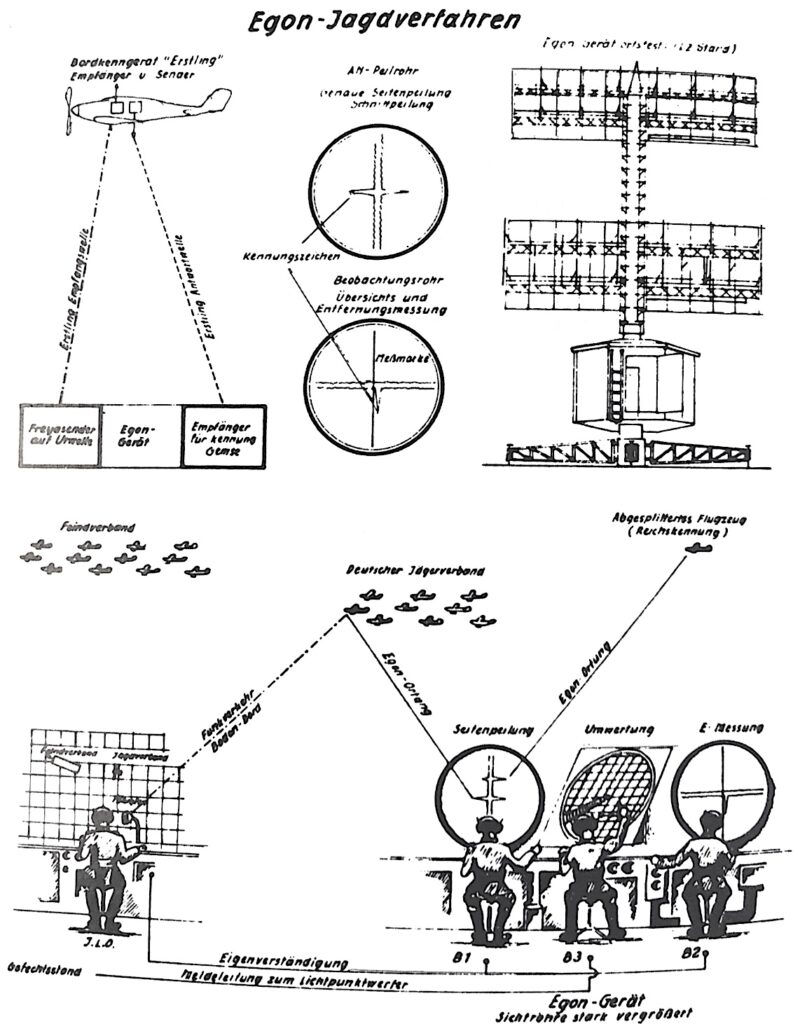
Graphik: Quelle 27, Seite 202
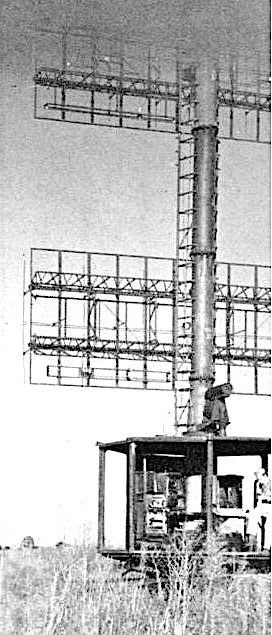
Bild: Wikipedia
Das ebenfalls zunächst zur Jägerleitung entwickelte „Peilruf-Verfahren“ (siehe unten) konnte aufgrund der starken Störungen des dabei genutzten UKW-Peil- und Sprechfunks durch die britischen „Cigarette“-Störsender nur kurzzeitig von Mitte April bis Juni 1943 genutzt werden.
Ingesamt gesehen, verfügte das Gros der deutschen Bomberverbände — im Gegensatz zu denen der Westalliierten mit „Gee“, „Oboe“ und „LORAN“ — trotz aller o.a. Funkführungsverfahren nicht über ein störsicheres Fernnavigationssystem für Nacht- und Schlechtwetterangriffe.
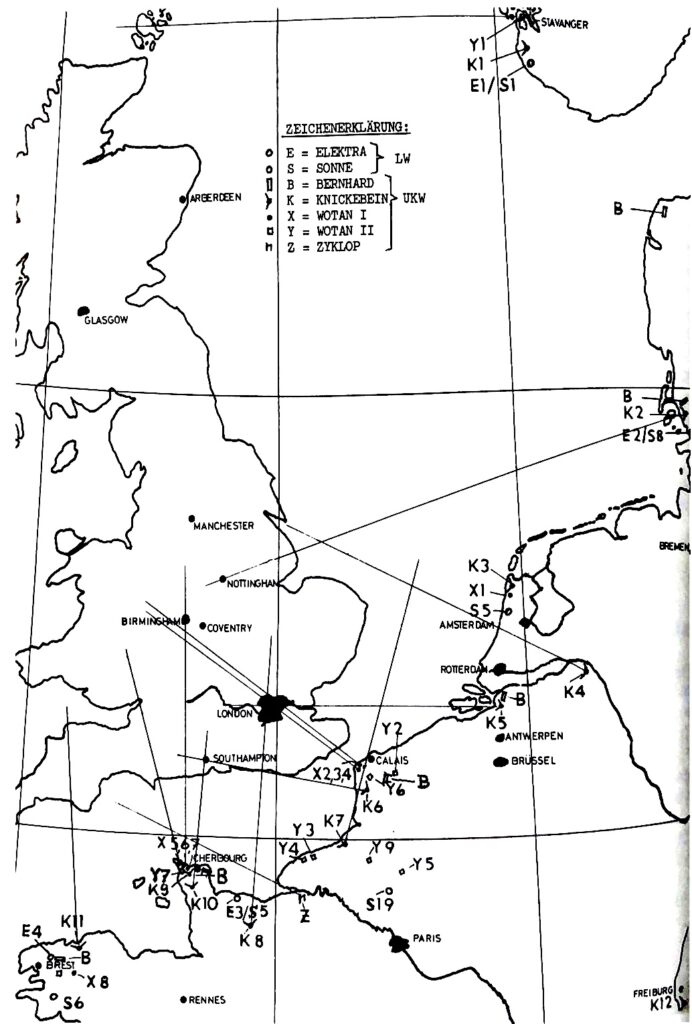
Wichtigste deutsche Funknavigations- und ‑führungsanlagen an Ärmelkanal und Nordsee,
Graphik: Quelle 27, Seite 127
Der Funkmeß- und Jägerleit-Dienst diente der Frühwarnung und Heranführung der deutschen Jagdverbände und ‑flugzeuge insbesondere an die westalliierten Bomberverbände auf deren Weg zu Angriffszielen im Deutschen Reich. Hierzu eingesetzt wurde durch die LnTr eine Vielzahl von Frühwarn- und Höhenmeß-Radargeräten, insbesondere das Frühwarn-Radargerät „FREYA“ — zunächst auf einer Festfrequenz von 125 MHz, später auch in den Frequenzbereichen 121 — 138 MHz, 134 — 144 MHz, 91 — 100 MHz, 120 — 158 MHz, 158 — 250 MHz und 75 — 120 MHz, um gegnerische Stör- sowie Täuschmaßnahmen zu erschweren, und mit einer Reichweite von bis ca. 70 km (Einzelflugzeuge) bzw. bis ca. 130 km (Flugzeugverbände) sowie einer Peilgenauigkeit von bis zu ± 0,1° und hieraus entwickelte weitere Varianten (u.a. „WASSERMANN“ mit einer Reichweite von bis ca. 300 km über Land bzw. bis ca. 380 km über See) sowie das Höhenmeß-Radargerät „WÜRZBURG-RIESE“ auf einer Festfrequenz von ca. 560 bzw. 125 MHz und mit einer Reichweite von bis ca. 60 km sowie einer Entfernungsmeßgenauigkeit bei ± 25 m, Seitengenauigkeit bei ± 0,2° und Höhengenauigkeit bei ± 0,1°.
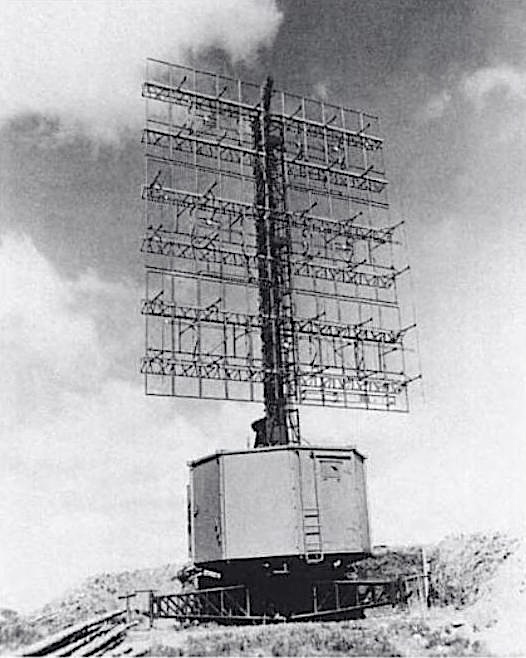
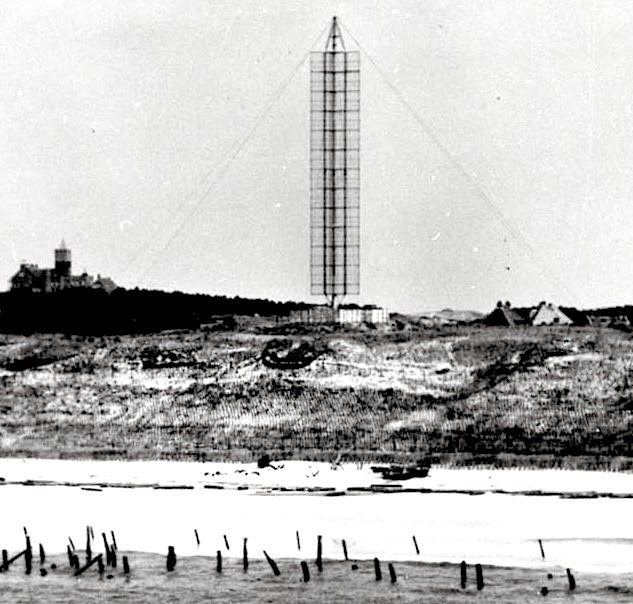

Frühwarn-Radargeräte „FREYA“ und „WASSERMANN“ sowie das Höhenmeß-Radargerät „WÜRZBURG-RIESE“,
Bilder: Wikipedia
Darüber hinaus wurden u.a. das „EGON-Tag- und ‑Nachtjagdverfahren“ (EGON = „Erstling“-„Gemse“-Offensiv-Navigation), das „Peilruf-Verfahren“, das „Y‑Tag- und ‑Nachtjagd-Verfahren“, das „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ sowie das „Himmelbett-Verfahren“ zur „Dunklen Nachtjagd“ und UKW-Boden-/-Bord-Sprechfunk zur Jägerleitung genutzt.
Beim „EGON-Tag- und Nachtjagdverfahren“ kamen die gleichen Geräte wie beim „EGON-Verfahren“ für deutsche Bombenangriffe in Großbritannien (siehe oben) zum Einsatz. Das „Peilruf-Verfahren“ beruhte auf der Peilung von Peilzeichen, die durch die Jagdflugzeuge auf derselben Frequenz im UKW-Bereich gesendet wurden, auf der auch welcher auch der Sprechfunkverkehr durchgeführt wurde, und ggf. auf Kurskorrekturen sowie Lageinformationen über Positionen, Kurse und Höhen gegnerischer Bomberverbände durch die Peilstelle am Boden.
Beim „Y‑Tag- und ‑Nachtjagd-Verfahren“ bzw. „WOTAN III“ wurde die Messung der Entfernung des o.a. „Y‑Verfahrens“ bzw. von „WOTAN II“ zu einem Jagdflugzeug mit dessen Peilung durch eine entsprechende Bodenstation kombiniert, um seine Position festzustellen und es dann aufgrund von Funkmeßergebnissen an die gegnerischen Bomberverbände heranzuführen.
Das „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ war die Kombination von besserer Darstellung der durch Radar ermittelten Jäger- und Feindbomberpositionen mittels Leuchtpunkten auf dem sogenannten „Seeburg-Tisch“ mit dem ersten Jägerbordradargerät „Liechtenstein“ (490 MHz, 1,5 kW), womit die in die Nähe gegnerischer Bomberverbände geführten Jagdflugzeuge diese eigenständig erfassen konnten.

Nachtjäger Ju 88 mit „Liechtenstein“-Antenne,
Bild: Wikipedia
Beim „Himmelbett-Verfahren“ wurden das „Y‑Tag-Nachtjagd-Verfahren“ bzw. „WOTAN III“ mit dem „Seeburg-Liechtenstein-Verfahren“ kombiniert, wodurch allerdings der Personalaufwand zur Führung eines einzigen Jagdflugzeugs auf fast 140 Personen am Boden stieg — zudem waren die „Würzburg“- sowie „Liechtenstein“-Radargeräte anfällig für gegnerische Störungen und es versagte beim Einsatz gegen dichtaufgeschlossene Bomberströme sowie unter 1.000 m Flughöhe, was z.B. bei dem britischen Großangriff auf Hamburg Ende Juli 1943 u.a. durch den gegnerischen „Düppel“- und Bordstörsender-Einsatz zu seinem schlagartigen Totalversagen führte.
Zumindest die Nachtjagd-Verfahren waren gemäß dem General der Jagdflieger, Generalleutnant Adolf Galland spätestens ab Anfang 1945 aufgrund des gegnerischen Störmitteleinsatzes wirkungslos und die dazu genutzten Geräte sollten deshalb durch neue ersetzt werden.
Eine systematische Funkmeß-Beobachtung/-Aufklärung, d.h.: Aufklärung gegnerischer Funkmeß- bzw. Radar-Geräte oder Elektronische Aufklärung durch die LnTr — unterstützt durch die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) und das Reichspost-Zentralamt (RPZ) — begann erst ab Frühjahr/-sommer 1940 unmittelbar nach der deutschen Besetzung der französischen Ärmelkanal-Küste (siehe unten), nachdem noch im Frühjahr/Sommer 1939 bei Meßflügen mit den beiden letzten deutschen Luftschiffen im Ärmelkanal parallel zur britischen Küste keine britischen Radar-Signale erfasst worden waren, obwohl man bereits ab 1938 im Rahmen des Baus des deutschen Westwalls Impulsendungen zwischen 21 und 25 MHz sowie zwischen 26 und 29 MHz sowie bereits zu Beginn des II. Weltkriegs festgestellt hatte, daß von Großbritannien aus Funkmeß- bzw. Radaranlagen zur Erfassung anfliegender deutscher Flugzeuge genutzt worden waren. Dazu wurden — auch von der Kriegsmarine mobile Trupps unter Leitung von Wissenschaftlern an markanten Punkten eingesetzt, um nach britischen Radarausstrahlungen zu suchen, diese zu erfassen und zu analysieren. Dabei wurde ermittelt, daß diese zu verschiedenartigen Radargeräten gehörten und es konnten ihre Sendefrequenzen, Impulsfolgefrequenzen sowie Impulsdauern festgestellt werden.
Genutzt wurden dabei zunächst behelfsmäßige UKW-Peilgeräte der DVL (14 — 104 MHz) und des RPZ (15 — 120 MHz), wobei aus letzteren eine neue Reihe von Funkmeßbeobachtungsempfängern entwickelt wurde, von denen als Frequenzbereiche 25 — 100 MHz, 75 — 150 MHz, 150 — 250 MHz, 170 — 220 MHz (auch durch die Kriegsmarine genutzt) und 200 — 300 MHz bekannt sind. Die damit ausgestatteten Peilstellen der LnTr wurden zur Tarnung als „Windmeß“- („WIM“-) Stellen bezeichnet. Für ihren mobilen Einsatz waren sie in einem einachsigen Anhänger mit einem 4m-Mast untergebracht, wobei die Antennenköpfe für die verschiedenen o.a. Frequenzbereiche auswechselbar waren.
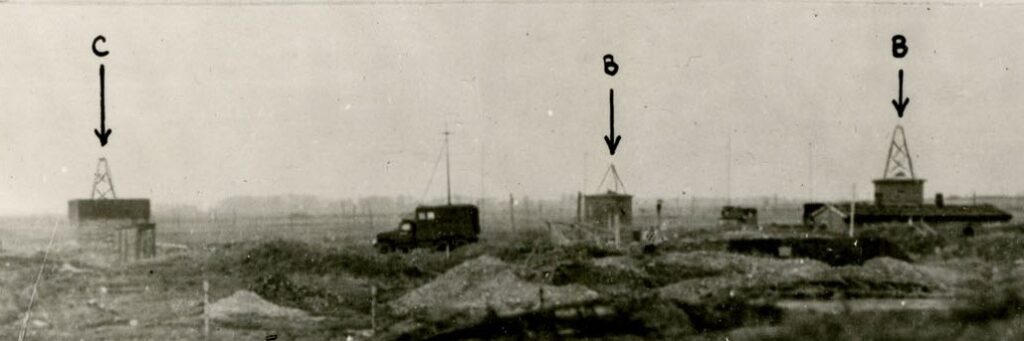
Ab 1943 kamen dann auf Grundlage der zwischenzeitlich für U‑Boote der Kriegsmarine entwickelten Radar-Warnempfänger weitere Funkmeßbeobachtungsempfänger bzw. ‑peilanlagen in den Frequenzbereichen 100 — 180 MHz, 100 — 300 MHz, 120 — 375 MHz, 150 — 300 MHz, 400 — 800 MHz, 800 — 1.600 MHz, 2,4 — 12,0 GHz und 2,5 — 3,75 GHz sowie ab 1944 in den Frequenzbereichen 3,75 — 5,0 GHz, 5,0 — 7,5 GHz und 7,5 — 11,0 GHz zum Einsatz.
Die im Rahmen der Funkmeßbeobachtung gewonnenen Erkenntnisse über gegnerische Radargeräte wurden durch die LnTr vor allem zur Funkmeß-Störung und ‑Täuschung dieser Radargeräte genutzt, während sie bei der Kriegsmarine auch zur Warnung vor Erfassung durch Radargeräte und bevorstehendem Waffeneinsatz dienten.
Zur Funkmeß-Störung insbesondere der britischen Küsten-Radarstationen wurden u.a. künstliche, mit deren Impulsen synchronisierte Radarechos erzeugt, die es unmöglich machten, in dem so entstehenden „Radarecho-Wald“ die echten Radarechos auszumachen. Deutsche Einsätze von „Düppeln“ zur Funkmeß-Täuschung durch Vortäuschung von zusätzlichen Flugzielen bei Bombenangriffen auf Großbritannien waren aufgrund der Typenvielzahl an britischen Radargeräten und entsprechend unterschiedlichen Frequenzen im Gegensatz zu den britischen Düppeleinsätzen gegen die wenigen deutschen Radartypen mit Festfrequenzen kaum erfolgreich. Dagegen gelang es in Einzelfällen mit „Ball-Radar-Störanlagen“ (siehe unten) zusätzliche Flugzeuge vorzutäuschen, während auch der material- und arbeitsaufwendige Einsatz von „Tripel“-Winkelreflektoren (-„Spiegel“) auf Seen in der Nähe von Städten zur Täuschung der britischen Flugzeug-Rundsuch-Radargeräte „H2S“ bzw. „Rotterdam“, die vor allem zum Zielanflug genutzt wurden, kaum wirksam war, da es nur unvollkommen gelang, deren charakteristische Konturen auf dem Radarbild zu verändern.
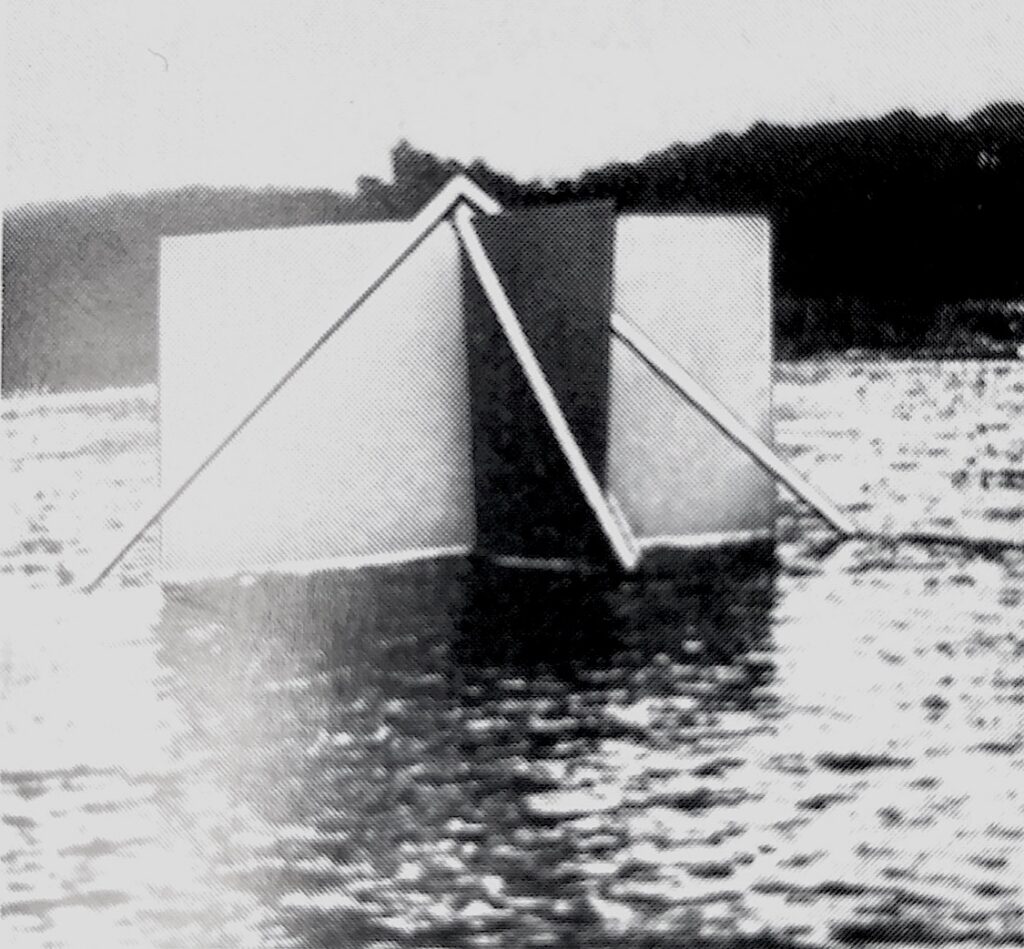
„Tripel“-Winkelreflektoren (-„Spiegel“) auf einem See,
Bild: Quelle 21, Seite 139
Auch die Bordfunker der Flugzeugbesatzungen gehörten der LnTr an, die 1938 bereits eine Personalstärke von 35.460 hatte, bis zum Frühsommer 1939 bei der „Aufstellungsübung 1939“ im Rahmen der Vorbereitung des Polenfeldzuges auf ca. 68.000 aufgewachsen war und nach Abschluß der Mobilmachung ca. 138.000 umfasste.
Im September 1939 wurden im Polenfeldzug bei der 10. Armee zur zeitweiligen ausschließlichen Führung über Funk u.a. auch Fliegerstaffeln mit sogenannten „Nachrichten-Ju 52“7 eingesetzt, die eigentlich dazu vorgesehen waren, eine Erst-Erreichbarkeit über Funk im Rahmen der Verlegung von Luftwaffengeschwadern auf neue Feldflugplätze sicherzustellen.
Am 18. Dezember 1939 kam es zur ersten deutschen Radarortung eines anfliegenden britischen Bomberverbands mit 22 Flugzeugen durch die auf Helgoland und Wangerooge stationierten „FREYA“-Radargeräte zur Flugmeldung und Jägerführung, welche diesen bereits in rund 100 km Entfernung erfassten, worauf in dem ersten radargeleiteten Luftgefecht 12 der britischen Bomber durch deutsche Jagdflugzeuge abgeschossen werden konnten.
Beim Westfeldzug im Frühjahr 1940 waren die Nachrichtenverbindungen zu den Luftwaffenverbändeninsgesamt mangelhaft, wodurch es u.a. zu Bombardierungen der eigenen Truppe, aber auch von Rotterdam kam, obwohl erstmals u.a. Fliegerleittrupps der LnTr bei Heeresverbänden eingesetzt wurden und sogar zwei separate rückwärtige Freileitungslinien für die Nachrichtenverbindungen zu den Luftflotten durch die fünf Bau- sowie vier Betriebs-Regimenter der LnTr gebaut und betrieben wurden.
Im Frühsommer 1940 wurde die LnTr im Norwegenfeldzug zusammen mit der HNachrTr nach der norwegischen Kapitulation ab 10. Juni zu Instandsetzung und Ausbau des oberirdischen norwegischen Fernsprech-Freileitungsnetzes eingesetzt, wobei auch Seekabel durch die Fjorde verlegt und alle Flugplätze in Norwegen an das Luftwaffenführungsnetz angeschlossen wurden. Diese norwegischen Nord-/Süd-Drahtverbindungen waren später ab 1941 auch wichtig für die Koordinierung der Luftangriffe auf die alliierten Konvois nach Murmansk in der Sowjetunion. Ergänzend dazu wurden durch die LnTr auch Richtfunkverbindungen von Oslo über das Nordkap bis nach Finnland eingerichtet und betrieben. Diese Richtfunkverbindungen der LnTr trugen im Herbst 1944 wesentlich dazu bei, daß eine Fernsprech- und Fernschreibverbindung über eine Entfernung von ca. 4.500 km — neben Funk- und direkten Richtfunkverbindungen — zwischen dem Oberkommando der HGr Kurland in Riga/Lettland und dem OKH im Lager „Mauerwald“ in Ostpreußen mittels einer „Umwegschaltung“ über Estland — Finnland — Nord-Finnland/-Norwegen — Norwegen — Dänemark — Hamburg — Berlin hergestellt und betrieben werden konnte, nachdem die Landverbindung zwischen Lettland und Ostpreußen durch den sowjetischen Vorstoß an die Ostsee-Küste unterbrochen worden war.

Fernsprechverbindung zwischen Oberkommando der HGr Kurland in Riga/Lettland und OKH im Lager „Mauerwald“ in Ostpreußen im Herbst 1944,
Graphik: Post 26
Richtfunkverbindungen wurden durch die LnTr auch zu den ägäischen Inseln (1941 — 1945) und nach Nordafrika (1941 — 1943), insbesondere gegen Ende des Afrikafeldzugs zum Brückenkopf um Tunis(November 1942 — Mitte Mai 1943) sowie in die Kessel von Demjansk (Anfang Februar — Ende April 1942) und Stalingrad (Ende November 1942 — Anfang Februar 1943) hergestellt sowie betrieben.
Ab Juli/August 1940 wurde eine Reihe von ortsfesten Funkmeß-Beobachtungstellen entlang des Ärmelkanals eingerichtet, mit denen die verschiedenen britischen ortsfesten und verlegefähigen Frühwarn-Radarstationen in den Frequenzbereichen um 25, 43 und 83 MHz sowie in Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine auch Flugzeugbordradargeräte zur Suche von Schiffen — insbesondere aufgetaucht fahrenden U‑Booten — im Frequenzbereich 170 — 180 MHz und Schiffsbord- sowie Land-Radargeräte im Frequenzbereich 200 — 250 MHz erfaßt sowie in ihren Funktionen zugeordnet werden konnten. Außerdem wurden dort auch Funkmeß-Störstellen (siehe unten) eingerichtet, die ab 1941 durch eine zentrale Funkmeß-Beobachtungs- und ‑Auswertestelle bei Calais gesteuert wurden.
In der Nacht vom 16./17. Oktober 1940 erfolgte der erste radargeleitete deutsche Nachtjagd-Luftsieg, bei der ein britischer Bomber über der Zuidersee abgeschossen wurde.
Im Rußlandfeldzug ab Frühsommer 1941 wurde neben dem „Drehkreuznetz“ der HNachrTr noch ein zweites oberirdisches, ebenfalls auf der „Drehkreuztechnik“ (aber mit „Rechtsdrall“) beruhendes Liniennetz der Luftwaffe aufgebaut, das durch 10 Telegraphenbau- und acht ‑Betriebs-Regimenter sowie sechs Telegraphenbetriebs-Abteilungen der Luftnachrichtentruppe eingerichtet, unterhalten und betrieben wurde.
Spätestens ab 1942 wurde die Funkmeß-Beobachtungsorganisation von der Ärmelkanalküste auf Sizilien, Kreta, Bulgarien, Dänemark und Norwegen ausgeweitet. Dabei hatten noch 1942 die Briten den deutschen „FREYA“- und „WÜRZBURG“-Radargeräten zur Flugmeldung und Jägerführung bzw. zur Jägerführung und Höhenmessung nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen, obwohl deren Weiterentwicklung meist nur halbherzig betrieben wurde bis es zu spät war: Nach Einstellung der deutschen Entwicklungsarbeiten mit den sogar weniger störanfälligen, aber hinsichtlich ihres Rückstrahlverhaltens falsch eingeschätzten Zentimeterwellen (3 — 30 GHz) erzielten die Briten durch deren Einbeziehung in das „Duell im Äther“ ab 1942 einen kriegsentscheidenden Vorsprung, so daß u.a. dadurch ab 1943 die deutsche Luftherrschaft über den Reichsgebiet endgültig verloren ging.
Im Rahmen des Durchbruchs der deutschen Schlachtschiffe „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ sowie des Schweren Kreuzers „Prinz Eugen“ am 11./12. Februar 1942 durch den Ärmelkanal von Brest nach Wilhelmshaven („Operation Cerberus“) gelang es jedoch noch der LnTr (im Rahmen der „Operation Donnerkeil“ der Luftwaffe) und der landgestützten Marine-Funkmeßortungs- (= Radar), ‑beobachtungs- (= Elektronische Aufklärung) und ‑störorganisation durch gemeinsame und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Funkmeßstörung und ‑täuschung (= EloGM) u.a. der britischen Küsten-Radarstationen, die Entdeckung des o.a. deutschen Schiffsverbandes bis zur Passage der engsten Stelle bei Dover — Calais zu verhindern bzw. so zu verzögern, daß die britischen Fernkampf-Küstenbatterien bei Dover nur kurzzeitig gegen den deutschen Schiffsverband wirken konnten, dabei aber u.a. auch aufgrund der deutschen Störung der britischen Radarentfernungsmessung keine Treffer erzielten.

Graphik: Quelle 21, Seite 118
Hierbei wurden u.a. durch die deutschen Radar-Störsendeanlagen der LnTr „Breslau I“ (22 — 28 MHz) bei Boulogne und „Breslau II“ (40 — 50 MHz) bei Dieppe sowie mehrere Radar-Störsendestellen „Karl“ bzw. „Olga“ der Marine (170 — 220 MHz) künstliche, mit den Impulsen der britischen Küsten-Radarstationen in den Frequenzbereichen um 25 MHz, 45 MHz und 200 MHz synchronisierte Radarechos erzeugt, die es unmöglich machten, in dem so entstehenden „Radarecho-Wald“ die echten Radarechos auszumachen — ohne jedoch zu ahnen bzw. zu wissen, daß bereits einzelne britische Küsten-Radarstationen im Bereich um 3.300 MHz („9 cm“) in Betrieb waren, denen es zwar gelang, den deutschen Schiffsverband zu orten, deren Meldungen aber erst mit Verspätung vorlagen. Zudem hatten schon die starken o.a. deutschen Radarstörungen zum Ansatz von Luftaufklärung geführt, deren Sichtmeldung aber erst nach Landung der Aufklärungsflugzeuge weitergeleitet wurde und somit auch erst mit Verspätung einging.
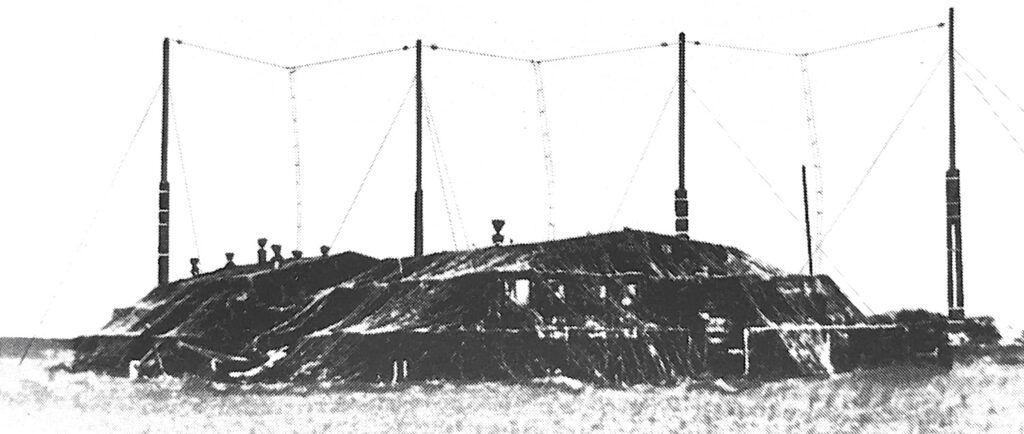
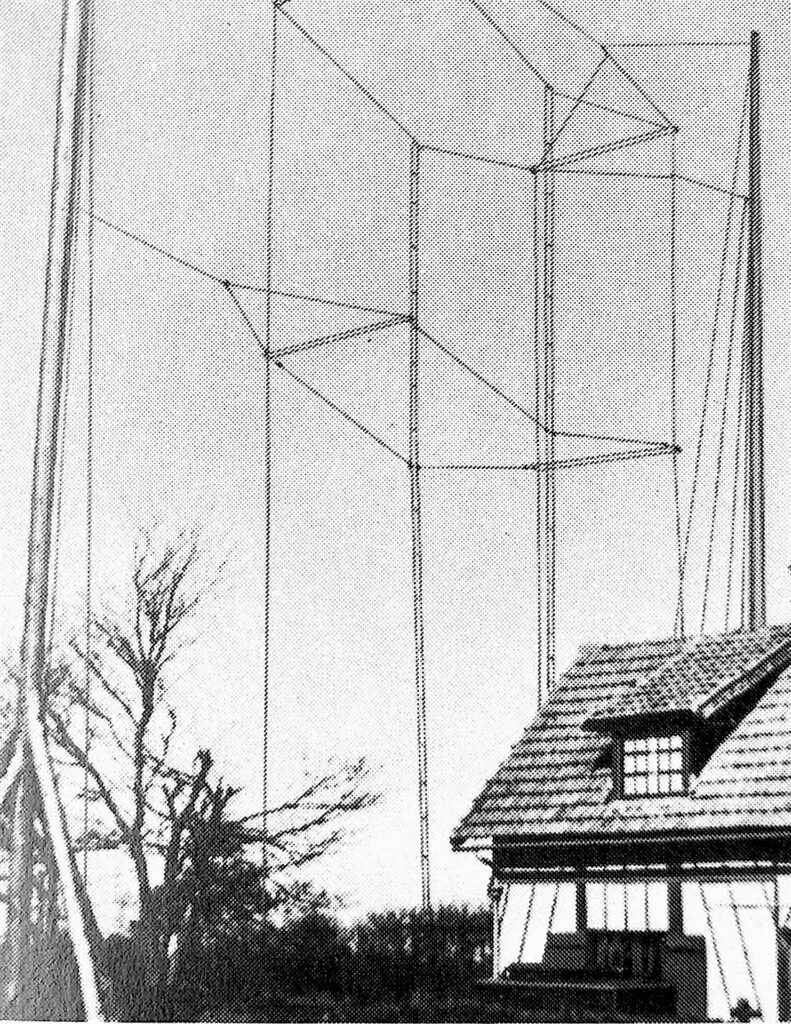
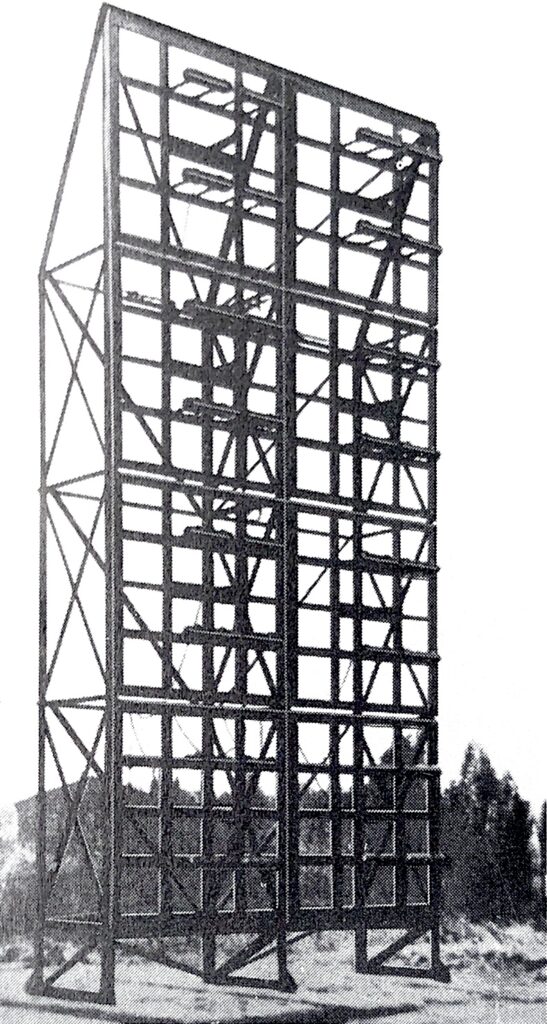
Bilder: Quelle 21, S. 117 und 118 sowie S. 98
Darüber hinaus wurde auch durch zwei deutsche Flugzeuge mit jeweils fünf „Ball-Radar-Störanlagen“8 („Garmisch-Partenkirchen“; 15 — 70 MHz) im westlichen Ärmelkanal ein Jagdfliegerverband vorgetäuscht, um von den Jagdflugzeugen zum Schutz des bereits nach Osten marschierenden deutschen Schiffsverbandes abzulenken.
Umgekehrt gelang der Luftnachrichtentruppe die frühzeitige Erfassung der britisch-kanadischen Landungsflotte bei der „Test-Seelandung“ in Dieppe Mitte August 1942 durch ein küstennahes FREYA-Radargerät bei Pourville bereits auf ca. 35 km Entfernung und somit eine noch rechtzeitige Warnung der deutschen Küstenverteidigungskräfte.
Nach dem ersten erfolgreichen Einsatz von ca. 40 to (!) Düppel beim britischen Luftangriff auf Hamburg im Juli 1943 („Operation Gomorrha“), der die deutschen FREYA- und WÜRZBURG-Radargeräte zur Frühwarnung bzw. Leitung des Flak-Feuers vollständig lahmlegte, wurden als Gegenmaßnahmen die Verfahren „Freya- bzw. Würzlaus“ zur Festzeichenunterdrückung bzw. Moving Target Indication (MTI) entwickelt und eingesetzt, welche auf der Anwendung des Dopplereffekts beruhten, der beim Radarecho-Empfang von Flugzeugen gegenüber den Radarechos der sich nicht wesentlich bewegenden Düppel auftritt, wodurch es der LnTr wieder möglich war, Flugziele zu erfassen und Jagdflugzeugen bzw. der Flak zur Bekämpfung zuzuweisen.
Mit den ersten Funkmeßbeobachtungsempfänger bzw. ‑peilanlagen im Frequenzbereich 2,5 — 3,75 GHz konnten ab Herbst 1943 auch die britischen Flugzeug-Rundsuch-Radargeräte „H2S“ bzw. „Rotterdam“, die im Zentimeterwellenbereich um 3 GHz arbeiteten und vor allem zu Flugnavigation genutzt wurden, bereits auf Entfernungen von mehreren 100 km geortet werden.
Vor der westalliierten Seelandung in der Normandie am 6. Juni 1944 gab es entlang der ca. 300 km Küste zwischen Dieppe und Cherbourg 50 deutsche Radarstellungen von Luftwaffe und Kriegsmarine mit insgesamt 12 unterschiedlichen Typen von Radargeräten, wobei jeweils zwei Radargeräte zur Küsten- und Luftraumüberwachung zusammenwirkten. Aufgrund von Ausfällen der Stromversorgung durch Bombardierungen, Sabotage und Betriebsstoffmangel waren diese jedoch bei Beginn dieser Seelandung nur noch teilweise einsatzbereit: So arbeiteten im eigentlichen Abschnitt der einzelnen Seelandungen kurz vor deren Beginn nur noch ca. 20% der ursprünglich dort festgestellten Radargeräte, in den entscheidenden Stunden unmittelbar vorher sogar nur noch ca. 10%. Auch die vier „Funkdörfer“ zur Funkaufklärung, Funkmeßbeobachtung und ‑störung bei Cherbourg, Dieppe und Boulogne waren in den Tagen vor dieser Landung mit jeweils mindestens 500 to bombardiert worden, so daß auch diese nur noch teilweise einsatzbereit waren.
Durch Störung der dadurch nur wenigen verbliebenen deutschen Radargeräte in den Landungsabschnitten sowie Vortäuschung eines Landungsverbands zwischen Le Havre und Calais konnte so durch die LnTr, aber auch durch die Funkmeßortungs- und ‑beobachtungsorganisation der Kriegsmarine die tatsächliche westalliierte Seelandung in der Normandie nicht frühzeitig erkannt werden, was zu zu später Alarmierung der deutschen Führungsstellen, falscher deutscher Lagebeurteilung und falschem Ansatz der deutschen gepanzerten Gegenangriffskräfte beitrug.
1944 erreichte die LnTr eine Maximalpersonalstärke von ca. 500.000, davon ca. 150.000 Ln-Nachrichtenhelferinnen und hatte so eine fast 60% größere Personalstärke als die NachrTr des Heeres mit über ca. 220.000 ohne Nachrichtenhelferinnen.
Anfang Februar 1945 wurde mit Masse aus Kompanien der Luftnachrichtentruppe (LnTr) ein Wehrmachts-Eisenbahn-NachrRgt „West“ gebildet und dem Oberbefehlshaber West unterstellt, das als Hauptaufgabe die Wiederherstellung der durch westalliierte Jagdbomberangriffe stark beschädigten Eisenbahnnachrichtenverbindungen hatte, um zur Aufrechterhaltung des Transportwesens beizutragen; andererseits wurde aus NachrAbt der LnTr und HNachrTr sowie einer Funkkompanie der Kriegsmarine das Wehrmachts-NachrRgt „Ruhr“ aufgestellt, dessen Hauptauftrag die Instandsetzung der im Ruhrgebiet durch westalliierte Luftangriffe besonders stark betroffenen Nachrichtenanlagen und ‑verbindungen war.
Bei Kriegsende waren noch 31 LnRgt – davon drei Funkhorch-Rgt, 164 selbständige LnAbt — davon fünf Richtfunkverbindungsabteilungen und drei Funkhorch-Abt, 130 selbständige LnKp — davon 16 Richtfunkverbindungskompanien im Einsatz, wobei die Ln-Funkaufklärungsverbände noch zwischen 90 und 100% der Feind-Luftlageinformationen für die deutschen Luftwaffenstäbe lieferten.
Soweit nicht zerstört, wurde das Fernmeldenetz der Luftwaffe — insbesondere ihr Richtfunkanteil in Westdeutschland — nach Kriegsende teilweise im ursprünglichen Abteilungs- und Kompanierahmen unter deutscher Führung für die britischen und amerikanischen Streitkräfte wieder betriebsfähig gemacht und später den deutschen Postbehörden übergeben.

Luftwaffen-Richtfunkverbindungen im deutschen Reichsgebiet
im April/Mai 1945,
Graphik: Quelle 1, Seite 168
Bei der Kriegsmarine verlagerte sich im II. Weltkrieg der Schwerpunkt des Marinenachrichtendienstesauf das Sicherstellen der Nachrichtenverbindungen zu den in See befindlichen U‑Booten. Dazu wurde der Marinefunkverkehr durch sogenannte „Funkschaltungen“ geregelt, mit denen ihren Operationsgebieten sogenannte „Großfunkräume“ und diesen wiederum bestimmte Frequenzen zugeordnet wurden. Durch Erfassung der mit dem deutschen ENIGMA-Marinefunkschlüssel verschlüsselten Funksprüche sowie kryptoanalytische Lösung des ENIGMA-Verfahrens unter Einsatz erster elektromechanischer Rechenanlagen, aber auch aufgrund mehrfacher Erbeutung von ENIGMA-Schlüsselgeräten und ‑mitteln, gelang es den Alliierten jedoch immer wieder, diese Funksprüche zumindest teil- und zeitweise zu entziffern sowie auszuwerten, und hieraus insbesondere Informationen zum Umgehen der deutschen U‑Boot-Gruppen („Wolfsrudel“) durch Schiffskonvois oder zum gezielten Angriff auf einzelne deutsche U‑Boote zu gewinnen.
Die verheerenden Verluste an U‑Booten (784 von 863 eingesetzten = ca. 91% !) und ihren Besatzungen (über 30.000 von über 40.000 = ca. 75% !), aber auch spektakuläre Einzelverluste wie Schlachtschiff „Bismarck“ und Schlachtkreuzer „Scharnhorst“ wurden trotz o.a. „“Blindfunkverfahren“, „Kurzsignalen“, um die Möglichkeit von Funkpeilungen zu verringern, und ENIGMA-Verschlüsselung u.a. auch durch zu langes Funken in Verkennung der gegnerischen Funkpeil- und ‑horch- sowie Auswerte- und Rechnerkapazitäten mitverursacht.
Hinzu kamen aber auch noch die weiträumige Seeraumüberwachung durch Langstrecken-Aufklärungsflugzeuge mit Radar im Dezimeter- und nach Erfindung des Magnetrons im Zentimeterbereich (H2S). Ab Herbst 1942 wurden die deutschen U‑Boote deshalb mit Radarwarnempfängern („METOX R 600“ im 600-MHz-Bereich und „NAXOS“ im 3‑GHz-Bereich) ausgerüstet. Trotzdem wurden etwa 200 (= ca. 26%) von den o.a. insgesamt 784 U‑Booten nach Ortung mit dem H2S-Radargerät versenkt.
Ähnlich wie die deutsche Luftwaffe bzw. LnTr unterhielt auch die Kriegsmarine eine umfangreiche landgestützte Funkmeßortungs‑, ‑beobachtungs- und ‑stör-Organisation insbesondere entlang der westeuropäischen Küsten, die mit zum Teil den gleichen Funkmeßgeräten arbeitete und zum Teil auch mit entsprechenden Funkmeßstellen der deutschen Luftwaffe bzw. LnTr kolloziert war sowie zur Unterstützung von gemeinsamen Operationen (siehe oben) auch gemeinsam mit diesen zum Einsatz kam, sonst aber weitgehend getrennt betrieben wurde.
Ab der Besetzung Norwegens 1940 wurde das „Netz“ der Marine-Funkaufklärung schrittweise bis an die Peripherie des deutschen Machtbereichs ausgeweitet, so daß es 1943 seine größte Ausdehnung erreichte, wobei es 1942 zu einer weiteren Umbenennung der bisherigen „Marine-Funkstellen“ in Marine-Peilstellen (MPS) und Marine-Haupt-Peilstellen (MHPS) kam — darüber hinaus wurden Marine-Peilabteilungen (MPAbt) neu geschaffen, falls eine MHPS sonst mehr als Kompaniestärke gehabt hätte.
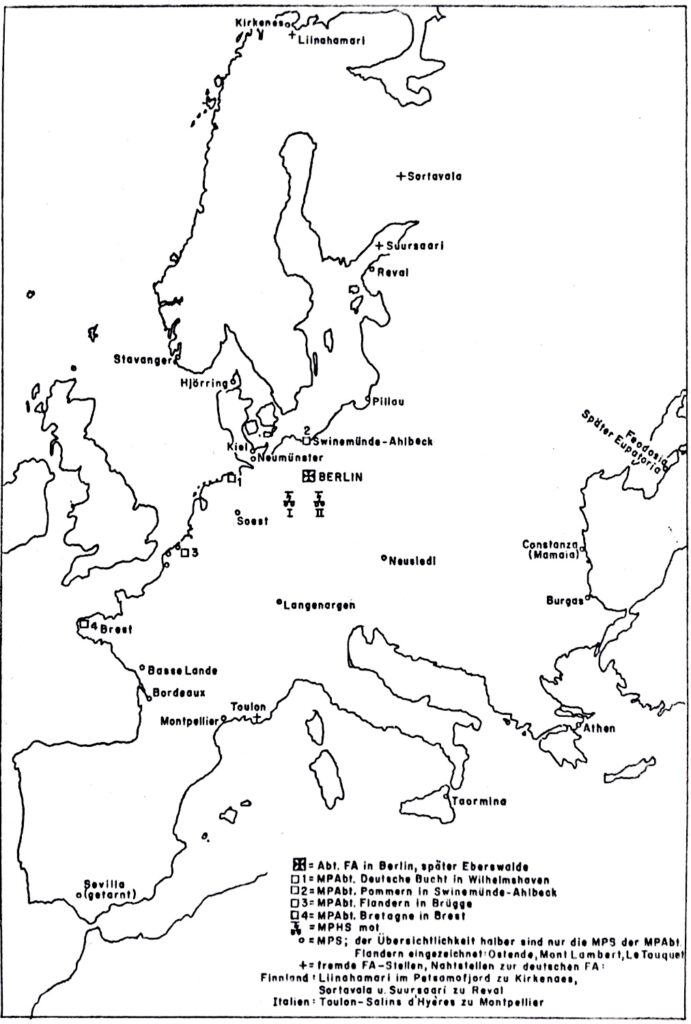
Marine-Funkaufklärungsnetz im Jahr 1943,
Graphik: Quelle 7, Seite 102
Die Zurücknahme und Auflösung einzelner MPS ab 1943 hatte bis Ende September noch keinen wesentlichen Ausfall an Erfassungs- bzw. Peilergebnissen zur Folge — erst im April 1945 wirkten sich die Verluste an MPS auch im Reichsgebiet in ihrem starken Rückgang aus, weshalb die Marine-Funkaufklärung gegen die Westalliierten bereits ab Anfang Mai teilweise eingestellt wurde: Die noch verbliebenen MPHS Flensburg, Stavanger, Neumünster, Langenargen, Rantum und „Mot I“ sowie die Zentrale der Marine-Funkaufklärung in Flensburg stellten erst auf britische Weisung ihren Betrieb am 9. Mai 1945 endgültig ein.
Insgesamt hatte die deutsche Marine-Funkaufklärung im II. Weltkrieg eine Personalstärke von ca. 5.000 — 6.000, dabei allein ca. 1.100 in der Abteilung „Funkaufklärung“ der Seekriegsleitung von denen ca. 200 in der Nachtschicht eingesetzt waren, und verfügte schon seit Ende der 1930-er Jahre über besondere Funkempfänger für scharfe Frequenzabstimmung oder breit abgestimmten Suchempfang sowie ab 1943über einen besonders brauchbaren Sichtfunkpeiler, der schnelle sowie zuverlässige Peilungen ermöglichte und ab diesem Jahr wurden auch erstmals Hollerith-Maschinen zur statischen Auswertung von Lochkarten in die Entzifferungsarbeiten miteinbezogen.
Die Landorganisation der deutschen Marine-Funkaufklärung erbrachte zwar zusammen mit dem Luftwaffen-Peil- und ‑Horchnetz umfassende Ergebnisse für den operativen und taktischen Kräfteansatzbei allen ihren Seekriegsoperationen — insbesondere aber im Rahmen der U‑Boot-Kriegführung, ergänzt noch durch Ergebnisse der Funkmeßortung (= Radar) und ‑beobachtung (= Elektronische Aufklärung), letztlich aber überwogen die o.a. Kapazitäten an Kräften und Mitteln der Westalliierten im sogenannten „Hochfrequenzkrieg“ bzw. in der sogenannten „Schlacht im Äther“.
Die grundsätzlich aber unverändert vorhandene Leistungsfähigkeit des Marinenachrichtendienstes konnte dieser jedoch noch einmal innerhalb der letzten vier Monate des II. Weltkriegs im Rahmen der Evakuierungstransporte von u.a. mehr 2 Millionen Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches durch die Kriegsmarine über die Ostsee eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Bereits vor der Aufstellung der Bundesmarine ab 1956 gab es schon wieder ab 1951 beginnend deutsche Marineeinrichtungen unter alliierter Leitung, die Fernmeldeaufklärung gegenüber Aktivitäten der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Bereich der Ostsee betrieben: So waren die deutschen Schnellboote aus dem II. Weltkrieg des auch als Schnellbootgruppe „Klose“ bezeichneten „British Baltic Fishery Protection Service“ (BBFPS) mit Peilantennen ausgestattet und wurden ab 1951 mit deutschen (!) Besatzungen auch für Fernmeldeaufklärung eingesetzt, wobei hauptsächlich Küstenstellungen im Baltikum einschließlich der verwendeten Funkfrequenzen aufgeklärt wurden. Darüber hinaus erbrachte ihre Fernmeldeaufklärung wertvolle Erkenntnisse über die im Wiederaufbau befindliche sowjetische Baltische Flotte, über die im Westen sonst sehr wenig bekannt war. Ab 1. Januar 1954 wurde außerdem eine ortsfeste Land-Funkerfassungsstelle eingerichtet, die von zunächst sieben ehemaligen Angehörigen des „B‑Diensts“ betrieben wurde und ab Juni 1955 in der ehemaligen Marinenachrichtenschule und späteren Marinefernmeldeschule sowie Schule für Strategische Aufklärung und heutigen Außenstelle des Ausbildungszentrums Cyber- und Informationsraum im ehemaligen Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik untergebracht sowie als „U.S. Naval Service Detachment No. 3“ getarnt war.
Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr
Beim Wiederaufbau der erst ab Anfang der 1960-er Jahre so genannten Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr konnten diese ab 1956 auf die o.a. umfangreichen und detaillierten Erfahrungen ihrer Vorgängerorganisationen insbesondere in der Wehrmacht im II. Weltkrieg zurückgreifen, da zunächst noch zahlreiche Offiziere und Unteroffiziere der früheren Wehrmacht zur Verfügung standen, an deren Kenntnisse und Fertigkeiten angeknüpft werden konnte.
Eine bruchfreie Fortsetzung ihrer Vorgängerorganisationen gab es jedoch nicht, da u.a. der bisherige Begriff „Nachrichtenwesen“ — wie auch beim Heer — durch „Fernmeldewesen“ zu ersetzen war und weil es bei der Luftwaffe keine Truppengattungen sowie „Nachrichtenführer“ mehr gab. Stattdessen wurden in der Luftwaffe einzelne Tätigkeitsgebiete unter dem Begriff “Dienstbereich” zusammengefasst, wobei sich für den Bereich, deren Aufgaben in der Wehrmacht durch die Ln-Truppe wahrgenommen worden waren, ab Anfang 1960 der Ausdruck “Führungsdienst” als Bezeichnung einbürgerte.
Der Aufbau des Führungsdienstes in der neu aufzustellenden Bundes-Luftwaffe begann ab Anfang Juni 1956, als unter Leitung des Kommandos der Schulen der Luftwaffe, das direkt dem Führungsstab der Luftwaffe im BMVg unterstellt war, und mit tatkräftiger Unterstützung durch die US Air Force die beiden Technischen Schulen der Luftwaffe in Kaufbeuren (TSLw 1) sowie in Lagerlechfeld (TSLw 2) aufgestellt wurden. Diese hatten die Aufgabe, Luftwaffenpersonal in den Dienstbereichen „Radarführung und Flugmeldedienst“, „Fernmeldeverbindungsdienst“ sowie „Flugsicherung“ auszubilden. Ab Anfang Juli 1956 begannen auch beim Luftwaffenausbildungsregiment 1 in Uetersen erste Einführungslehrgänge: Im Lehrgang C waren ehemalige Angehörige der Luft- und Heeresnachrichtentruppe sowie Nachrichtenpersonal der früheren Kriegsmarine zusammengefasst, aus dem sich nach und nach „Spezialzüge“ herauskristallisierten, darunter ein sogenannter „H‑Zug“, der ehemalige Horchfunker zusammenfasste, und ein Zug früherer Auswerter im Nachrichtenwesen, von denen der „H‑Zug“ mit zwei Offizieren und 42 Unteroffizieren im September 1956 nach Nörvenich verlegte sowie der dort stationierten Fernmelde-Lehr- und Versuchskompanie als IV. Zug angegliedert wurde. Darüber hinaus wurde im August 1956 auch schon ein Vorkommando für eine „Zentrale für Funk- und Radarbeobachtung“ in Porz-Wahn beim Allgemeinen Luftwaffenamt in der Gruppe „Fernmeldewesen“ aufgestellt.
Als erste Truppenteile des Führungsdienstes der Luftwaffe wurden ab Ende 1956/Anfang 1957 zunächst die Fernmelde-Lehr- und Versuchskompanie der Luftwaffe (FmLVsuKpLw) in Nörvenich — 1957 nach deren Verlegung nach Sonthofen zur Fernmelde-Lehr- und Versuchsabteilung (FmLVsuAbt) 612 erweitert sowie nach Lagerlechfeld verlegt und schließlich 1961 in Fernmelde-Lehr- und Versuchsregiment (FmLVsuRgt) 61 umgegliedert.
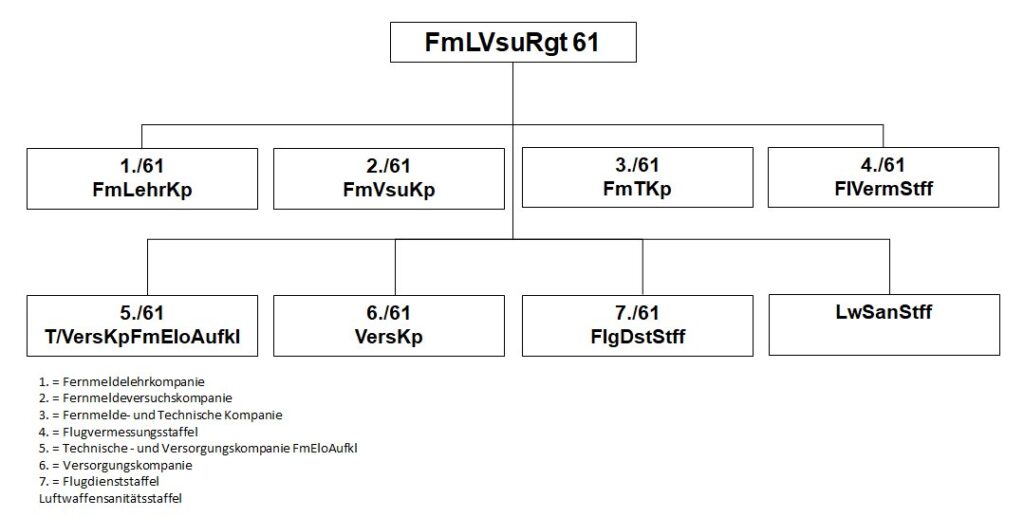
Gliederung von FmLVsuRgt 61 ab Juli 1964, Bild: Quelle 7
sowie die zunächst den Kommandos der Luftwaffenbodenorganisation Nord und Süd, den späteren Luftwaffengruppenkommandos Nord und Süd unterstellten Fernmeldeabteilungen 111 und 121 an den Standorten Münster/Osnabrück und Karlsruhe aufgestellt, die Anfang der 1960-er Jahre zu den Fernmelderegimentern (FmRgt) 11 und 12 aufwuchsen. Sie bestanden aus je zwei Fernmeldeabteilungen sowie einer Flugsicherungsabteilung und betrieben in der Nord- bzw. Südhälfte der damaligen Bundesrepublik Deutschland das inzwischen aufgebaute Luftwaffen-Richtfunknetz, die Fernmeldezentralen der Luftwaffen-Kommandobehörden und ‑Gefechtsstände sowie ab 1972 die Rechenzentren des Elektronischen Informations- und Führungssystems für die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe („EIFEL“).
Nach Aufstellung der Flugmeldeabteilungen 312 und 332 Anfang 1958 für den zunächst Flugmelde- und ‑leitdienst (FlgM/LtDst) genannten Radarführungsdienst (Radar-FüDst) im Süd- und Nordraum der damaligen Bundesrepublik Deutschland zeichnete sich sehr schnell dessen Integration in das System der NATO-Luftverteidigung ab, so daß diese bereits im Herbst 1959 die ersten amerikanischen und britischen Radar-Stellungen in Türkheim und Brekendorf übernahmen. 1960/61 wurden aus ihnen die Fernmelderegimenter 31 — 34 aufgestellt und den beiden Luftverteidigungsdivisionen zugeordnet. Ihr Auftrag war der Betrieb der Kampfführungsanlagen im Rahmen der integrierten NATO-Luftverteidigung. Auch ein herkömmlicher, “Auge/Ohr” genannter Luftraumbeobachtungsdienst (LRB) wurde an der innerdeutschen Grenze aufgestellt und wie die Radarstellungen — allerdings im Frieden in nationaler Verantwortung (als “earmarked forces”) — im 24-Stundendienst betrieben.
Im Dienstbereich „Elektronische Kampfführung“ (EloKa) begann der IV./FmLVsuKpLw in Nörvenich ab September 1956 mit den Vorbereitungen zur Aufnahme des Kurzwellenempfangs, zeitgleich begann eine noch provisorische Sprachausbildung. Durch die Installierung von Langdrahtantennen auf dem Fliegerhorst Nörvenich schaffte man den Durchbruch und in einer Empfangs-/Auswertestelle „klickerten” ab Oktober 1956 permanent Morsezeichen aus den Empfängern. Im Dezember 1956 wurde die Zentrale für Funk- und Radarbeobachtung beim Allgemeinen Luftwaffenamt selbständig und erhielt 1957 die Bezeichnung „Zentralauswertung der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung“.
Unter Rückgriff auf den IV./FmLVsuKpLw und zuversetztes BGS-Personal begann ab Anfang Januar 1957 die Aufstellung von Fernmeldeabteilung 711 (FmAbt 711), die sich bereits Anfang Februar 1957 schon soweit aufgefüllt und konsolidiert hatte, so daß eine erste Gliederung in einen Stab und zwei Kompanien, die erste — den späteren Fernmeldesektor C — und die fünfte — den späteren Fernmeldesektor N — sowie Ende Februar 1957 die Verlegung der Abteilung an die Standorte Osnabrück und Bückeburg erfolgen konnte.Dabei verlegten der Stab FmAbt 711, die 5./FmAbt 711 und der „Empfangszug Telegrafie“ der 1./FmAbt 711 nach Osnabrück, wo der Kurzwellenempfang wieder aufgenommen wurde, und die übrige 1./FmAbt 711 nach Bückeburg. Bereits Ende Mai 1957 verlegte aber die 1./FmAbt 711 schon wieder nach Göttingen.
Anfang März war der erste HF-Peiler in Westerkappeln mit fünf Peilfunkern in Betrieb genommen worden und Anfang Mai 1957 hatte FmAbt 711 ihre erste Stärke- und Ausrüstungsnachweisung (STAN) erhalten, nach der sie sich mit einer Soll-Personalstärke von 51/559/490//1.100 + 54 Zivilpersonal neben Stab und Sanitätsstaffel in vier Fernmeldekompanien (A, B, C und D) sowie eine Fernmeldeauswertekompanie gliederte. Noch in Bückeburg wurde Mitte August 1957 die 2./FmAbt 711 aufgestellt, die jedoch bereits im September nach Osnabrück verlegte, wo ebenfalls im September 1957 die 4./FmAbt 711 in Osnabrück aufgestellt wurde, die sich als künftige Radar-Erfassungskompanie aus der 1./FmAbt 711 und den Erfassern der 5./FmAbt 711 rekrutierte, wodurch letztere eine reine Auswertekompanie wurde. Zum 1. Oktober 1957 wurde Fernmeldeabteilung 711 der neu geschaffenen Luftwaffengruppe Nord in Münster unterstellt.
Nachdem die bereits ab Juni 1957 durchgeführten Empfangsversuche im Raum Göttingen befriedigende Ergebnisse gezeigt hatten, wurde Ende November 1957 auf der nur wenige Kilometer entfernt gelegenen Mackenroder Spitze eine provisorische Empfangsstelle für die 1./FmAbt 711 aufgebaut. Wenig später trafen amerikanische Partner mit Gerätewagen ein, um mit der Radar-Beobachtungs-/EloAufkl-Ausbildung des künftigen deutschen Betriebspersonals zu beginnen. Ebenfalls im November 1957 begann die 2./FmAbt 711 mit der Verlegung von Osnabrück nach Hambühren, wo sie die bisher vom 14. Signal Regiment des britischen Heeres (Hauptstandort Wesendorf bei Gifhorn) genutzte Kurzwellenerfassungsanlage einschließlich der Heptagon-Rundumempfangsantennenanlage übernahm.

Kasernenanlage Hambühren (links unterhalb der Gebäude die Heptagon-Rundumempfangsantennenanlage, rechts mehrere Rhombus-Antennen),
Graphik: Quelle 7
Auf dem Stockert (435 m) westlich von Bad Münstereifel war 1956 ein Radioteleskop mit 25 m Durchmesser fertig gestellt und am 19. Juli 1957 eingeweiht sowie seitdem durch die astronomische Fakultät der Universität in Bonn betrieben worden. Die US-Luftstreitkräfte in Europa (USAFE) schlossen im gleichen Jahr während eines EloAufkl-Einsatzes Geräte vom Typ AN/APR‑9 (1 — 10,75 GHz) an die Parabolantenne dieses Radioteleskops an und erfassten damit sowjetische Luftraumüberwachungs-Radargeräte bis in ca. 500 km Entfernung — eine Einstellung der Parabolantenne auf eine Elevation von — 2° machte dies möglich, wodurch auch z.B. die drei Luftkorridore nach Berlin überwacht worden sein sollen.
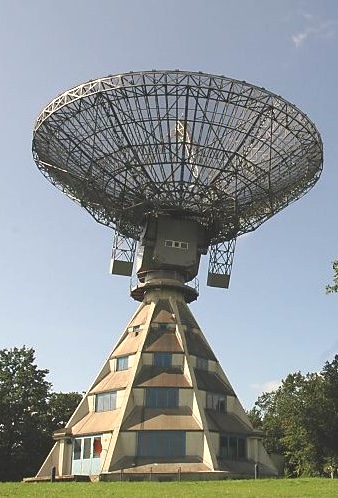
Radioteleskop „Stockert“,
Bild: Quelle 7
Mit Hilfe der USAFE setzte die Luftwaffe die militärischen Einsätze ab 1958 fort, wobei das militärische Personal im Erdgeschoss einen eigenen abgesicherten sowie blickgeschützten Betriebsraum nutzte und sich halbjährlich mit den zivilen „Himmelsforschern“, die nebenan ihren Betriebsraum hatten, in der Nutzung der Anlage abwechselte. Technologische Fortschritte im Bereich EloAufkl und eine damit verbundene Änderung des Einsatzkonzepts führten jedoch zur Beendigung des Luftwaffeneinsatzes auf dem Stockert im Jahr 1964: Neue Erkenntnisse hatten schließlich ab 1958 zur Planung sowie ab 1963 zur Errichtung stationärer und grenznaher Einsatzstellungen, letztendlich der fünf Fernmeldetürme der Fernmeldesektoren A, B, C, E und F geführt.
Ab 1. April 1958 begann die Aufstellung des der Luftwaffengruppe Süd (LwGrpS) in Karlsruhe unterstellten Fernmeldeführers „B“ Süd (FmFhr „B“ Süd), des späteren Fernmelderegiments 72 (FmRgt 72): Das Funk- und Radarbeobachtungspersonal sowie entsprechende Geräte mußten von der Fernmeldeabteilung 711 gestellt werden. Zwischenunterkunft auch für den neuen, für den Kurzwellenempfang zuständigen Fernmeldebeobachtungssektor H wurde die Ludwig-Frank-Kaserne (ehemals Lüttich-Kaserne) in Mannheim. Die endgültigen Standorte für die einzelnen Einheiten sollten sein:
- Stab Fernmeldeführer „B” Süd, Fernmeldebeobachtungssektor H, Fernmeldeauswertezentrum Süd und Luftwaffensanitätsstaffel in Feuchtwangen;
- Fernmeldebeobachtungssektor E im Raum Wunsiedel;
- Fernmeldebeobachtungssektor F im Raum Furth i.W.;
- Fernmeldebeobachtungssektor G im Raum Berchtesgaden (später nicht realisiert).
Zum 1. Mai 1958 wurde auch die FmAbt 711 in Fernmeldeführer „B“ Nord (FmFhr „B“ Nord) umbenannt, womit die erste Phase der Aufstellung abgeschlossen sowie folgende Gliederung und Stationierung eingenommen worden war:
- Stab FmFhr „B“ Nord sowie Fernmeldebeobachtungssektor A (FmBeobSkt A/VHF-Funk- und Radarerfassung) weiterhin im Aufbau, Fernmeldebeobachtungssektor D (FmBeobSkt D/Radarerfassung ?),
- Fernmeldeauswertezentrale Nord (FmAuswZentr Nord) und Luftwaffensanitätsstaffel (LwSanStff) in Osnabrück;
- Fernmeldebeobachtungssektor B (FmBeobSkt B/HF-Funkerfassung) in Hambühren;
- Fernmeldebeobachtungssektor C (FmBeobSkt C/VHF-Funk- und Radarerfassung) in Göttingen.
Damit waren auch die bisherigen Kompanien von FmAbt 711 in Fernmeldebeobachtungssektoren bzw. Fernmeldeauswertezentrale Nord umbenannt worden, wobei FmBeobSkt C aus 1./FmAbt 711, FmBeobSkt B aus 2./FmAbt 711, FmBeobSkt D aus 4./FmAbt 711 und FmAuswZentr Nord aus 5./FmAbt 711 entstanden. Die 3./FmAbt 711, bisher nur in Planungsunterlagen existent, wurde in FmBeobSkt A umbenannt.
Ab Juni 1958 wurden auch in Mannheim bei Fernmeldebeobachtungssektor H von FmFhr B Nord die ersten HF-Funkverkehre aufgenommen, nachdem die ersten Erfasser und Auswerter vom FmFhr B Nord dort eingetroffen waren. Im Gegenzug wurden die in den USA ausgebildeten HF-Horchfunker in Osnabrück eingesetzt. Die dortige FmAuswZentr Nord war nun mit Sofort‑, Haupt‑, Betriebs- und Endauswertung sowie Entzifferung arbeitsbereit.
Ab Oktober 1958 standen dem FmBeobSkt D folgende Kurzwellenpeiler zur Verfügung: Feuchtwangen-Tauberschallbach, Westerkappeln, Husum, Hambühren und Flensburg-Mürwik, während Fernmeldebeobachtungssektor H Mitte Oktober den Kurzwellenpeiler in Feuchtwangen übernahm. Damit wurde die Qualität der beiden HF-Peilbasen der FmFhr B Nord und Süd gesteigert. Für den FmBeobSkt C wurde im Oktober 1958 eine weitere Einsatzstellung auf dem Stöberhai im Harz in Betrieb genommen und in einer ersten Einsatzübung wurde die Meldungserstattung von den FmBeobSkt B, C und D an die FmAuswZentrNord erprobt.
Ab Anfang Februar 1959 wurde in Osnabrück der Fernmeldesektor A des FmFhr B Nord aufgestellt, der bereits als 3./FmAbt 711 vorgeplant war, und verlegte Ende Mai nach Großenbrode, wo nach dem Aufbau der Einsatzstellung “Strand” ab Anfang Juni 1959 die Betriebsaufnahme erfolgte.
Bereits im Mai 1959 wurde ein Luftwaffen-Peiltrupp nach Langenargen am Bodensee beordert, um dort eine HF-Peilstelle der Luftwaffe aufzubauen.
Ab Mitte Mai wurde der FmSkt S des FmFhr B Süd in Mannheim aufgestellt, welcher für die Auswertung des Erfassungsmaterials aus dem Bereich des FmFhr B Süd zuständig war.
Ab Mitte Oktober 1959 begann der noch in Hambühren stationierte FmSkt B im Raum Lüchow mit der Probeerfassung aus einer mobilen Aufklärungsstelle heraus, die bis Anfang 1960 betrieben wurde. Ab Herbst 1959 wurden die Sofort- und Tagesmeldungen sowie die Wochenberichte über Fernschreibleitungen von Osnabrück und Feuchtwangen zur Zentralauswertung in Porz-Wahn gesendet sowie dort zu einer taktisch/betrieblichen Gesamtlage zusammengefaßt — vor allem aber war sie für die zentrale Auswertung und Entzifferung der Kurzwellenerfassungen zuständig.
Ab November 1959 wurden auch erste Versuche einer luftgestützten Funkerfassung mit dem Luftfahrzeugtyp „Hunting Pembroke C Mk 54“ des Fernmelde-Lehr- und Versuchsregiments 61 durchgeführt, wobei das Erfassungspersonal vom FmFhr “B” Nord in Osnabrück kam — wo auch die Auswertung des erfassten Funksprechverkehrs erfolgte — und in Wunstorf zustieg, um entlang der damaligen innerdeutschen Grenze die russischen Streitkräfte in der DDR insbesondere während ihrer Manöver zu beobachten: Für die Erfassung waren Funkempfänger ESM 180 der Fa. Rohde & Schwarz eingerüstet.

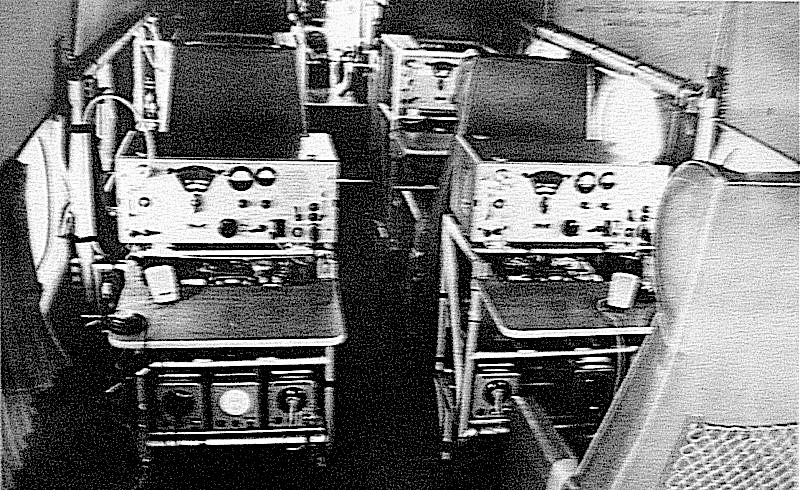
Hunting Pembroke C Mk 54 — Außen- und Innenansicht,
Bilder: Quelle 7
Im Januar 1960 wurde Fernmeldeführer B Nord in Fernmelderegiment 71 und Mitte 1960 Fernmeldeführer B Süd in Fernmelderegiment 72 umbenannt.
Mitte November 1960 wurde Fernmeldesektor E des FmRgt 72 in Thurndorf bei Pegnitz offiziell indienstgestellt, nachdem das Vorauspersonal schon ab Oktober 1959 im Raum Thurndorf Probeerfassungen durchgeführt hatte.
1961 wurde die Zentralauswertung der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung in „Zentrale für Funkanalyse“ umbenannt. Ab Februar 1961 wurde bei FmSkt A nach der Einsatzstellung „Strand“ eine zweite bei Klaustorf für Radarbeobachtung und VHF-Empfang eingerichtet. Im Juni 1961 verlegte FmRgt 72 mit Stab, FmSkt H und FmSkt S von Mannheim nach Feuchtwangen, wo schon Ende Juni FmSkt H den HF-Erfassungsbetrieb wiederaufnehmen konnte. Ende August 1961 übernahm FmSkt E nach schon vorheriger Mitbenutzung die Einsatzstellung der US-Army auf dem Schneeberg im Fichtelgebirge. Ab Anfang November 1961 wurde als letzter der Fernmeldesektor F des FmRgt 72 in Furth im Wald aufgestellt: Die Erfassungsstelle war jedoch schon im August auf dem Hohen Bogen im Bayerischen Wald in Betrieb genommen worden. In 1961 begannen auch konkrete Planungen zum Ausbau von sechs grenznahen Einsatzstellungen, von denen später (siehe unten) allerdings nur fünf realisiert wurden.
Ab Sommer bis Ende 1962 wurde luftgestützte Funkerfassung mit dem Luftfahrzeugtyp „Hunting PEMBROKE C Mk 54“ des FmLVsuRgt 61 auch zwischen Bebra und Passau — entlang der damaligen innerdeutschen und der Grenze zu Tschechien sowie innerhalb der damaligen Air Defense Identification Zone (ADIZ) — geflogen, um deutsche, russische und tschechische Flugfunk-Sprechverkehre zu erfassen. Die Flughöhen lagen zwischen 2.000 und 3.500 m, und die Einsatzdauer bei maximal drei Stunden. Das Erfassungspersonal für diese Einsätze kam vom Fernmeldesektor S (FmSkt S) aus Feuchtwangen, wo auch nach den Einsätzen die Auswertung der erfassten Funksprechverkehre durchgeführt wurde, und stieg auf dem Heeresfliegerhorst Niederstetten zu.
Ab 1963 begann der Bau der grenznahen Fernmeldetürme der Luftwaffe, die nach einer Bauzeit von jeweils ca. zwei bis drei Jahren in Betrieb genommen wurden, wobei die Einrüstung der neuen Fm-/EloAufkl-Geräte und ‑Antennen u.a. von dem in Lechfeld stationierten FmLVsuRgt 61 durchgeführt wurde: Baubeginn ab
- 1963 auf dem Schneeberg im Fichtelgebirge für FmSkt E als Prototyp für die anderen Türme, Inbetriebnahme im Juli 1965;
- 1964 auf dem Stöberhai im Harz für FmSkt C, Inbetriebnahme im Juni 1967;
- 1964 bei Klaustorf an der Ostsee für FmSkt A, Inbetriebnahme im Juni 1967;
- 1965 auf dem Thurauer Berg im Wendland für FmSkt B, Inbetriebnahme im Juli 1967;
- 1965 auf dem Hohen Bogen im Bayerischen Wald für FmSkt F, Inbetriebnahme im August 1967.
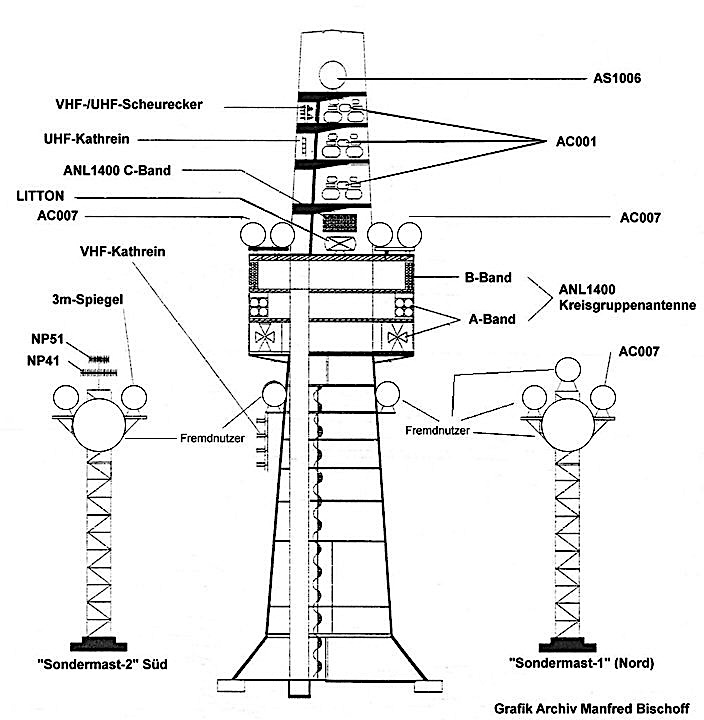
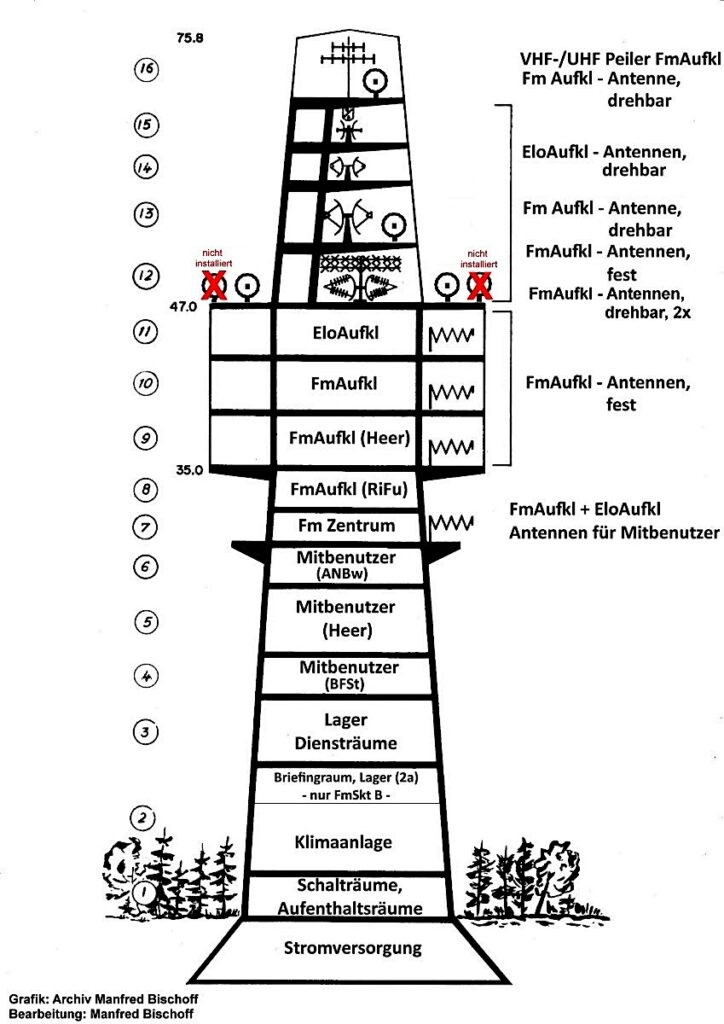
Fernmeldetürme der Luftwaffe — Antennenkonfiguration (Turm A) und Turmbelegung (Turm B), Graphiken: Quelle 7
Ab Anfang Dezember 1965 verlegte FmSkt E von Thurndorf nach Wunsiedel und in Langenargen/Eriskirch am Bodensee wurde nach zweijährigen Bauzeit eine neue Peilstelle fertiggestellt sowie von Luftwaffe und Marine in Betrieb genommen.


HF-Peilstelle der Luftwaffe in Langenargen, Bild: Quelle 7
Im Februar 1967 beteiligte sich erstmalig Erfassungspersonal der Luftwaffe an einem Aufklärungseinsatz auf einem Meßboot der Marine (siehe unten) in der Ostsee. Anfang März 1967 wurden die seit Mai 1959 in Langenargen/Eriskirch am Bodensee im Peildienst tätigen Soldaten in der neu aufgestellten Peilzentrale Süd zusammengefasst und FmRgt 72 unterstellt.
Aufgrund der Ergebnisse der Fm-/EloAufkl insbesondere der FmSkt E, F, H und S von FmRgt 72 während der Okkupation der CSSR durch Streitkräfte des Warschauer Pakts im August 1968 gelang es frühzeitig, die auf die CSSR begrenzte Aggression zu erkennen, aber in der Folge wurde auch die Zusammenarbeit zwischen Fm-/EloAufkl und Radarführungsdienst etabliert sowie intensiviert, um die Identifzierung von Flugzielen zu verbessern.
Im November 1968 verlegte FmSkt B von Hambühren nach Neutramm. Die in Hambühren verbliebenen Horchfunker waren bereits ab 1. November 1967 als II. Zug dem FmSkt D in Osnabrück angegliedert worden.
Ab Februar 1969 wurden mit vier Douglas C‑47D (je zweimal zur Fm- bzw. EloAufkl) der Flugvermessungsstaffel des Fernmelde-Lehr- und Versuchsregiments 61 unter der Deckbezeichnung “SCHWARZE DROSSEL” weitere Erprobungen einer luftgestützten FmEloAufkl-Erfassung durchgeführt.


Douglas C‑47D zur Fm- bzw. EloAufkl (rechts), Bilder: Quelle 7
Für die Dauer der Erprobungen — ca. 14 Tage — wurden u.a. aus Personal des Erfassungsteilbereiches „Flugfunk“ zwei Bordcrews gebildet. Die Maschinen, die von Technikern des FmRgt 71 mit Funkempfängern der ESM-Serie (ESM-180 und ESM-300) oder auch Empfängern vom Typ Telefunken E149 UK/1 zur Flugfunkerfassung ausgerüstet waren, flogen für diese Zeit vom Flugplatz Wunstorf bei Hannover aus entlang der damaligen innerdeutschen Grenze bzw. in der Air Defense Indentification Zone (ADIZ).


Douglas C‑47D zur FmAufkl — Innenansichten, Bilder: Quelle 7
Die Aufstellung der Verbände des Führungsdienstes in der Luftwaffe mit den Dienstbereichen „Fernmeldeverbindungsdienst“, „Flugsicherung“, „Radarführungsdienst“ und „Elektronische Kampfführung“ war damit im Wesentlichen Mitte 1965 abgeschlossen. Nicht unerwähnt bleiben sollen aber auch die Einheiten, die in Verbänden der anderen Dienstbereiche die Aufgaben des Führungsdienstes wahrzunehmen hatten und mit diesen aufwuchsen: So z.B. die Flugbetriebsstaffeln mit dem Schwerpunkt Flugsicherung in den fliegenden Verbänden sowie Fernmeldeverbindungsdienst-Einheiten bzw. ‑Teileinheiten in den FlaRak- und Flugkörper(FK)-Verbänden.
In der neu aufzustellenden Bundesmarine begann der Aufbau des Führungsdienstes ab 4. Juni 1956 mit der Aufstellung einer Marine-Funkaufklärungskompanie (MFuAufklKp) zur Aufklärung sowjetischer Seestreitkräfte aus der ortsfesten Land-Funkerfassungsstelle in Flensburg-Mürwik (siehe oben), die mit deren Aufstellung der 1. Marinefernmeldeabteilung (siehe unten) unterstellt sowie am 1. April 1957 in Marinefunkaufklärungsgruppe (MFuAufklGrp) umbenannt wurde, und ab Anfang Juli 1956 mit je einer Marinefernmeldeabteilung für die Kommandos der Befehlshaber der Seestreitkräfte in der Nord- und Ostsee.
Die in Flensburg-Mürwik aufgestellte 1. Marinefernmeldeabteilung wurde zum 1. April 1957 in Marinefernmeldeabschnitt Ostsee umbenannt und verlegte Anfang April 1959 nach Glücksburg, wohin 1960 auch das Kommando der Flotte verlegt wurde. Anfang April 1960 erfolgte die Umbenennung in Marinefernmeldeabschnitt 1 sowie nach Auflösung des Kommandos des Befehlshabers der Seestreitkräfte in der Ostsee Ende August 1961 die Unterstellung unter das Kommando der Flotte und Anfang Oktober 1974 unter das Marineführungsdienstkommando.
1. Marinefernmeldeabteilung/Marinefernmeldeabschnitt Ostsee bzw. 1 unterstanden neben der oben bereits angesprochenen MFuAufklGrp zunächst nur zwei Marine-Fernmeldegruppen: Die Marinefernmeldegruppe 11 in Glücksburg war die für das Kommando der Flotte bzw. spätere Flottenkommando zuständige Einheit und stellte dessen Verbindung zu den Einheiten in See sicher, wofür sie über drei Funksendestellen und zwei Funkempfangstellen verfügte, die über Schleswig-Holstein verteilt waren.
Dagegen war die Marinefernmeldegruppe 12 in Kiel für den Landfernmeldedienst im Ostseebereich und in Hamburg zuständig, wofür sie über eine Anzahl von Fernschreibstellen sowie die Marinesignalstellen in Kiel-Friedrichsort und in Olpenitz verfügte. Diese Marinesignalstellen dienten dem Fernmeldeverkehr - auch mit Flaggensignalen und Morse-Scheinwerfern — zwischen Landdienststellen der Marine und Marineschiffen im Küstenbereich.
Die in Cuxhaven aufgestellte 2. Marinefernmeldeabteilung wurde bereits zum 15. Dezember 1956 in Marinefernmeldeabschnitt Nordsee umbenannt. Am 1. April 1960 erfolgte dann die Umbenennung in Marinefernmeldeabschnitt 2 und am 1. April 1964 seine Verlegung nach Sengwarden an den Standort des Befehlshabers der Seestreitkräfte in der Nordsee. Am 1. Oktober 1974 wechselte seine Unterstellung unter das Marineführungsdienstkommando. Auch 2. Marinefernmeldeabteilung/ Marinefernmeldeabschnitt Ostsee bzw. 2 unterstanden zunächst nur zwei Fernmeldegruppen: Das Personal für Marinefernmeldegruppe 21 wurde am 20. August 1956 in Wilhelmshaven von den US-Streitkräften übernommen und der 2. Marinefernmeldeabteilung unterstellt. Sie war anfangs auf dem Wohnschiff „Knurrhahn“ untergebracht und wurde deshalb zunächst als Marinefunksendestelle „Knurrhahn“ bezeichnet. Am 1. April 1957 wurde sie in Marinefernmeldegruppe Wilhelmshaven umbenannt und zog später nach Sengwarden um. Am 1. April 1960 erhielt sie ihre endgültige Bezeichnung und war die für das Hauptquartier des Befehlshabers der Seestreitkräfte in der Nordsee zuständige Einheit sowie betrieb dessen Fernmeldezentrale für seine Verbindungen zu den Einheiten in See, wofür sie über mehrere Funksende- und Funkempfangsstellen im Nordseebereich verfügte. Dazu gehörten auch die Marinefunksendestelle Neuharlingersiel und für den Uboot-Funk die Marinefunksendestelle Rhauderfehn in Saterland-Ramsloh. Diese Längstwellen-Sendestation mit ihren 352 m hohen Sendemasten dient immer noch zur Verbindungsaufnahme mit den U‑Booten der Marine in ihren Einsatzgebieten, wobei diese Längstwellen auch im getauchten Zustand bis zu einer Wassertiefe von 20 m empfangen können. Die U‑Boote sind dagegen mit Kurzwellensendern ausgerüstet und müssen zum Senden eine Antenne über die Wasseroberfläche bringen, um so eine der Marine-Funkempfangsstellen zu erreichen.


Marinefunksendestellen Neuharlingersiel und Rhauderfehn,
Bilder: Wikipedia
Marinefernmeldegruppe 22 wurde als Marinefernmeldegruppe Cuxhaven ebendort aufgestellt, erhielt am 1. April 1960 ihre endgültige Bezeichnung, verlegte 1964 mit dem Abschnittsstab nach Sengwarden und war für den Landfernmeldedienst im Nordseebereich zuständig, wofür sie über eine Anzahl von Fernschreibstellen, Fernsprechvermittlungen und Marinesignalstellen verfügte.
Der Marine-Ortungsabschnitt Ostsee wurde am 1. Oktober 1957 in Flensburg-Mürwik aufgestellt und dem Marineabschnittskommando Ostsee unterstellt. Ihm unterstanden zunächst nur die ab 1. Dezember 1957 aufgestellten Marineortungsgruppen Flensburg (EloAufkl) und Mürwik (FmAufkl), die ab Mai 1958 durch einwöchige Einsätze des 1. Schnellbootgeschwaders mit der mobilen Erfassung begannen und ab September 1958 den Fernmeldeaufklärungsbetrieb in Pelzerhaken (Aufklärungsziele: Volksmarine der Nationalen Volksarmee (NVA-VM), sowjetische Baltische Flotte (BF) und Polnische Seekriegsflotte (PSF)) aufnahmen.
Ab 1. Dezember 1958 erfolgte eine vorübergehende Verlegung der Marineortungsgruppe Flensburg nach List/Sylt, wo erst wieder ab Anfang November 1959 der EloAufkl-Erfassungsbetrieb aufgenommen werden konnte. Ab Ende Januar 1959 wurde im DLRG-Turm Pelzerhaken die Marinefernmeldestelle 723 aufgestellt, die ihren Elektronischen Aufklärungsbetrieb ab Mitte März 1959 — im Schichtbetrieb ab Mitte Januar 1960 — aufnahm. Im Sommer 1959 erfolgte die Inbetriebnahme eines Peilers in Falshöft (zwischen Kappeln und Flensburg) sowie im Frühjahr 1960 die Aufstellung der Marinefernmeldestelle 711 (MFmSt 711) in Pelzerhaken und MFmSt 722 in Staberhuk auf Fehmarn zur Fm-/EloAufkl-Erfassung.
Zu den Aufgaben des Marine-Ortungsabschnitts Ostsee gehörte ab 1960 auch der Radar-Ortungsdienst an der schleswig-holsteinischen Ostküste sowie in der Nordsee, wofür ihm Marinefernmeldegruppe 53 und 62 unterstanden.
Marinefernmeldegruppe 53 wurde am 1. Juli 1960 in Neustadt in Holstein aufgestellt und betrieb die Küstenradarorganisation im Bereich der Ostsee mit den Marinefernmeldestellen 531 bis 534, deren Radarstationen sich auf Fehmarn und in Neustadt befanden. Außerdem betrieb sie seit Juni 1957 auf Fehmarn die Marinesignalstelle Marienleuchte sowie eine dortige Marineunterwasserortungsstelle, die in den 1960er Jahren mit dem Überwachungssystem „Holzauge“ betrieben wurde, das hauptsächlich aus unterwasser-akustischen Geräten bestand, aber in ihrer Funktion seit ihrem Bestehen durch den Fährbetrieb zwischen Puttgarden und dem dänischen Roedby stark eingeschränkt war.


Marinesignalstelle Marienleuchte, Bilder: Quelle 7
Deshalb wurde in den 1990er Jahren eine neue Anlage errichtet, die das Überwachungssystem „Holzauge“ ersetzen sollte: 1991 wurde nach dem dafür erforderlichen Umbau in den Gebäuden das „Große Seeohr“ installiert, dessen Kernstück drei unter dem Schifffahrtsweg des Fehmarnbelts verlegte Sensoren sind, und als „nationales Erfassungssystem“ in Betrieb genommen. Ab Mitte Januar 1993 wurde dann die Passivsonaranlage DWQX-12 in Marienleuchte eingeführt und erlaubt seitdem eine umfangreiche Erfassung sowie Analyse sowohl im Geräusch‑, als auch im Sonar- und Unterwassertelefonie-Bereich. Besonders ihre hohe Peilgenauigkeit ermöglicht mit Hilfe der Radar- und optronischen Sensoren eine präzise Zuordnung sowie schon auf relativ große Entfernungen Seefahrzeuge zu detektieren und zu klassifizieren.
Marinefernmeldegruppe 62 wurde am 1. Februar 1960 in Cuxhaven aufgestellt und war für die Küstenradarorganisation in der Nordsee verantwortlich. Diese wurde später stark reduziert und die Marinefernmeldegruppe 62 am 30. Juni 1976 aufgelöst. Einzig die Küstenradarstation auf Helgoland blieb weiter aktiv, ihr Betrieb wurde im Oktober 1988 von der Luftwaffe übernommen.
Am 1. April 1960 wurde der Marine-Ortungsabschnitt Ostsee in Marinefernmeldeabschnitt 5 umbenannt und am 30. September 1967 aufgelöst, wobei die inzwischen unterstellten Marine-Fernmeldegruppen 53 und 62 zu den Marinefernmeldeabschnitten 1 und 2 wechselten.
Marinefernmeldeabschnitt 7 wurde ab 1. September 1960 in Flensburg-Mürwik aus bereits bestehenden Einrichtungen der Marine zur Fernmelde- und Elektronischen, aber auch elektro-optischer und hydroakustischer Aufklärung aufgestellt, die zuvor dem Marinefernmeldeabschnitt Ostsee bzw. 1 (siehe oben) und dem Marine-Ortungsabschnitt Ostsee bzw. Marinefernmeldeabschnitt 5 (siehe oben) unterstanden hatten, wobei er selbst truppendienstlich dem Marineabschnittskommando Ostsee und für den Einsatz dem Befehlshaber der Seestreitkräfte in der Ostsee unterstand, ab 1961 dem Flottenkommando. 1967 wechselte die truppendienstliche Unterstellung zur Marinedivision Ostsee und ab Oktober 1974 zum Marineführungsdienstkommando, nachdem er am 1. Juli 1970 in Marinefernmeldestab 70 umbenannt worden war. Ihm unterstanden mehrere zunächst als Fernmeldegruppen, dann als ‑kompanien und schließlich ab Oktober 1978 als ‑sektoren bezeichnete Einheiten:
- Marinefernmeldegruppe/-kompanie/-sektor 71 in Flensburg-Mürwik;
- Marinefernmeldegruppe/-kompanie/-sektor 72 in Glücksburg-Meierwik, ab 1978 in Flensburg;
- Marinefernmeldekompanie/-sektor 73 in Neustadt in Holstein, mit Außenstelle in Marienleuchte auf Fehmarn.
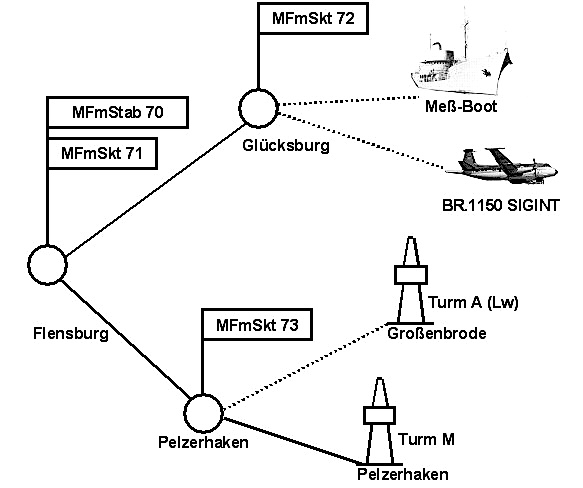
Fm-/EloAufkl der Marine 1980,
Graphik: Quelle 7
Marinefernmeldegruppe 71 wurde am 1. September 1960 in Flensburg-Mürwik zur Fernmeldeaufklärung aufgestellt, wozu ihm zunächst vier Marinefernmeldestellen unterstanden:
- MFmSt 711 in Neustadt-Pelzerhaken (Fmaufkl);
- MFmSt 712 in Soest (Peiler Mitte) mit Außenstelle in List/Sylt und abgesetztem Peiltrupp in Wittmund;
- MFmSt 713 in Falshöft bei Gelting (Peiler Nord), 1963 Verlegung ins Schlichtinger Moor bei Lunden;
- MFmSt 714 in Langenargen am Bodensee (Peiler Süd).
Ab Anfang November 1961 wurde auch die EloAufkl-Erfassung durch MFmGrp 71 in Flensburg-Mürwik aufgebaut. Im Frühjahr 1964 begann der Bau des Fernmeldeturms “M” in Pelzerhaken.
Ab Anfang April 1968 wurde die Marinefernmeldestelle 722 von Staberhuk nach Marienleuchte (Fehmarn) verlegt und begann dort die Fm-/EloAufkl-Erfassung. Ab Anfang Juli 1968 wurden MFmSt 713 in Lunden in Peilzentrale Nord und MFmSt 714 in Langenargen in Peilzentrale Süd umgegliedert sowie gleichzeitig beide dem MFmAbschn 7 unterstellt.
MFmGrp 71 wurde Ende April 1970 in Marinefernmeldekompanie 71 umbenannt, der nach mehreren Umgliederungen und Verlegungen nun nur noch
- MFmSt 711 in Neustadt-Pelzerhaken;
- MFmSt 713 in Lunden (Peilzentrale Nord);
- MFmSt 714 in Langenargen am Bodensee (Peilzentrale Süd).
unterstanden, während MFmSt 712 einschließlich der Außenstellen in List/Sylt und Wittmund aufgelöst wurde.
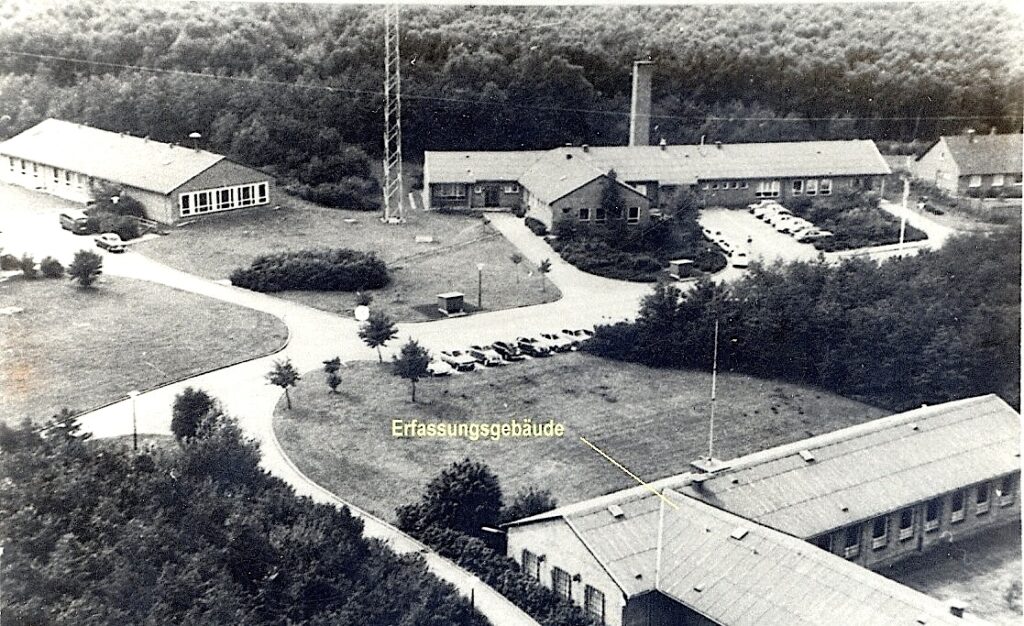
Marinefernmeldekompanie 71 in Flensburg-Mürwik in den 1970-er Jahren,
Bild: Quelle 7
Marinefernmeldegruppe 72 wurde am 1. Januar 1962 in Glücksburg-Meierwik aufgestellt, Ende April 1970 in Marinefernmeldekompanie 72 umbenannt und am 1. März 1978 nach Flensburg verlegt. Sein Personal wurde an Bord der als mobile Aufklärungseinrichtungen in und über See betriebenen Meß- bzw.Flottendienstboote und Messflugzeuge eingesetzt. Marinefernmeldesektor 72 wurde am 30. September 1982 aufgelöst und das Personal in den Stab des Marinefernmeldestabs 70 eingegliedert.
Mitte Oktober 1964 wurde die „Trave“ als erstes Meßboot, Anfang August 1968 das zweite Meßboot “Oste” und Mitte Oktober 1969 das dritte Meßboot „Alster“ in Dienst gestellt.

Meßboote „Trave“, “Oste” und „Alster“,
Bild: Quelle 7
Ende November 1971 wurde das erste Meßboot „Trave“ außer Dienst gestellt und Mitte Februar 1972 durch das neue Meßboot „Oker“ ersetzt. Die später als Flottendienstboote bezeichneten Meßboote „Alster“, „Oker“ und „Oste“ gehörten bis Ende 1992 zum Flottendienstgeschwader und wurden nach dessen Auflösung am 1. Januar 1993 Marinefernmeldestab 70 truppendienstlich unterstellt.


Flottendienstboote „Oker“ und „Oste“, Bild: Quelle 7
Die fünf Meßflugzeuge vom Typ Breguet 1159 M Atlantic gehörten stets dem Marinefliegergeschwader 3 an. Ab Anfang April 1971 begann die Ausbildung für ihre Bordeinsatzteams, Mitte November 1971erfolgte schon der erste Übungsflug und bereits Mitte Dezember 1971 der erste Einsatzflug.

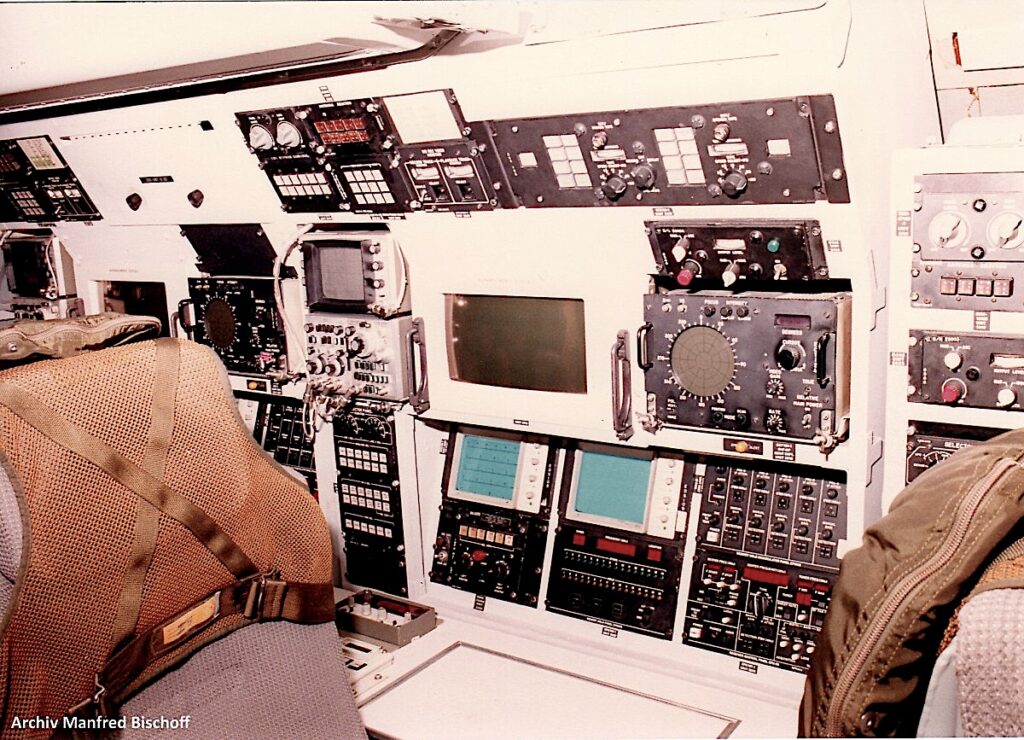
Meßflugzeuge „Breguet 1159 M Atlantic“ — Außen- und Innenansicht, Bilder: Quelle 7
Die späteren Patrouillenflüge mit den Meßflugzeugen wurden überwiegend über der östlichen Ostsee, z.B. während des NATO-Einsatzes gegen Serbien in 1999 aber auch über der Adria, durchgeführt, wobei in einer Flughöhe von 30.000 ft (= 9.140 m) see- und landgestützte VHF-/UHF-Vbdg (20 MHz — 16 (?) GHz) sowie Radargeräte (500 MHz — 30 (?) GHz) in bis zu 400 km Entfernung erfasst werden konnten.

Erstflug eines Meßflugzeugs „Breguet 1159 M Atlantic“ unter Kriegsbedingungen am 27. März 1999, Graphik: Quelle 7
Marinefernmeldekompanie 73 wurde am 29. April 1970 in Neustadt in Holstein vor allem Fernmeldeaufklärung nahe der innerdeutschen Grenze aufgestellt und verfügte über eine stationäre Peileinrichtung, die ab Anfang Februar 1972 im Fernmeldeturm „M“ in Pelzerhaken bei Neustadt untergebracht war. Außerdem unterstand ihr eine Außenstelle in Marienleuchte auf Fehmarn (Marinefernmeldezug 736), die sowohl Fernmelde- wie auch Elektronische Aufklärung betrieb.

Fernmeldeturm „M“,
Bild: Quelle 7
Anfang der 1960-er Jahre war vorgesehen, einen mobilen Fernmeldeverband der Marine aufzustellen, der die Bezeichnung Marinefernmeldeabschnitt (mot) 3 tragen sollte. Zunächst wurden dessen beide Marinefernmeldegruppen (mot) 31 und 32 aufgestellt, dann wurde auf die Aufstellung des Abschnittsstabes verzichtet und die beiden Gruppen den Marinefernmeldeabschnitten 1 und 2 unterstellt. Marinefernmeldegruppe (mot) 31 wurde ab 3. Juli 1962 in Brake an der Unterweser aufgestellt und zunächst dem Marinefernmeldeabschnitt 2 unterstellt. Am 1. Oktober 1966 verlegte sie nach Flensburg-Mürwik und wurde dem Marinefernmeldeabschnitt 1 zugewiesen, wo sie die mobile Fernmeldekomponente für den Ostseebereich bildete. Am 1. April 1969 verlegte sie weiter nach Nieby-Sandkoppel und wurde zum 30. September 1995 aufgelöst.
Marinefernmeldegruppe (mot) 32 wurde ab 1. Oktober 1965 in Bremen-Lesum aufgestellt sowie dem Marinefernmeldeabschnitt 2 unterstellt und verlegte am 1. Juli 1971 nach Aurich. Sie bildete die mobile Fernmeldekomponente für den Nordseebereich und wurde am 30. September 1993 aufgelöst.
Nachdem die Zuständigkeit für den gesamten Bereich des Führungsdienstes der Luftwaffe zunächst ausschließlich beim Führungsstab der Luftwaffe im BMVg lag, waren Anfang der 1960-er Jahre wesentliche Teile der Planung und des Einsatzes des Führungsdienstes auf die im Luftwaffenamt neugebildete Inspektion „Führungsdienste der Luftwaffe“ verlagert und dieser Inspektion auch die luftwaffenweite Regelung von Einsatzfragen der Dienstteilbereiche übertragen worden. Aus dieser Inspektion entstand ab Oktober 1970 als Folge einer neuen Kommandostruktur das Luftwaffenführungsdienstkommando (LwFüDstKdo) als dem Luftwaffenamt unterstelltes Fach- und zugleich Divisionskommando. Ihm waren fachdienstlich alle Fernmelderegimenter vom Typ A (Fernmeldeverbindungsdienst und militärische Flugsicherung), vom Typ B (Radarführungsdienst) sowie vom Typ C (Fernmeldeelektronische Aufklärung) unterstellt. LwFüDstKdo wurde auch das ab Oktober 1971 neugebildete Amt für Flugsicherung der Bundeswehr unterstellt, welches als Fachkommando bundeswehrweite Aufgaben auf dem Gebiet der militärischen Flugsicherung wahrnahm.
Im Bereich der Fm-/EloAufkl-Auswertung entstand ab April 1971 aus der Zentrale für Funkanalyse sowie den aufgelösten FmSkt N und S der Fernmeldebereich (FmBer) 70 in Trier. Die Fm-/EloAufkl der Luftwaffe hatte 1971 einen Personalumfang von ca. 2.000, 1980 von ca. 3.800.
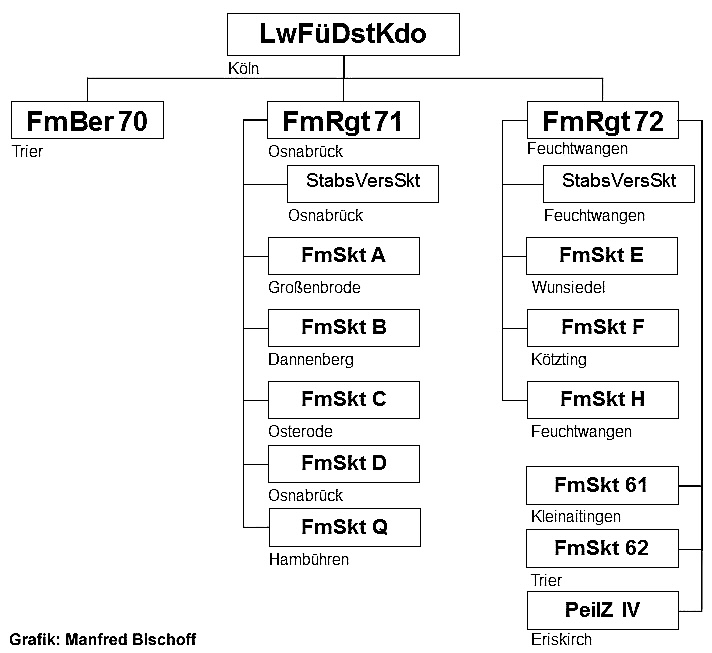
Gliederung der LwFm-/EloAufkl ab 1971,
Graphik: Quelle 7
Die sogenannte „Vordere Erfassung“ (Line-Of-Sight-Aufklärung mit bis zu 200 km Reichweite im Bereich 108 — 144 MHz gegen stationäre Boden-Flugfunkstellen und bis zu 300 km gegen Flugziele abhängig von deren Flughöhe, d.h. bis zur Mitte von Polen; ab 1973 auch Richtfunk-Erfassung) wurde durch die Fernmeldesektoren A, B, C, E und F aus festen Einsatzstellungen (Fernmeldetürmen) heraus betrieben. Für die sogenannte „Rückwärtige Erfassung“ (Kurzwellen-Aufklärung) standen den Fernmeldesektoren D und H spezielle Antennenanlagen zur Verfügung, während der Fernmeldesektor Q mit Sonderaufgaben (Technische Erfassung und Analyse) betraut war.
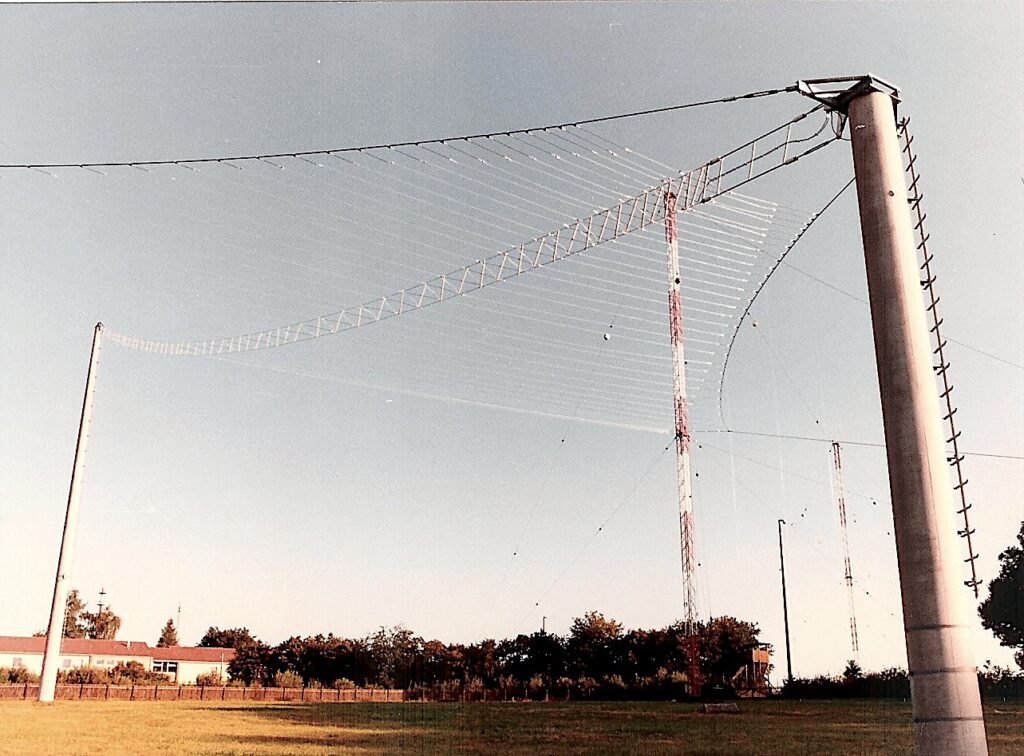
Bild 76: HF-Antennenanlage von FmSkt H,
Bild: Quelle 7
Die Auswertung der Erfassungsergebnisse aller Fernmeldesektoren erfolgte im FmBer 70 in Trier und FmSkt 61 sorgte für die technische sowie logistische Unterstützung der FmEloAufklLw. FmSkt 62 war und ist heute noch als Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme (ZEK Flg WaSys) die “Spezialeinheit” für Elektronische Kampfführung fliegender Waffensysteme der Bundeswehr.
1979 wurde aus dem LRB der Tieffliegermelde- und Leitdienst (TMLD), welcher — wie der LRB — die NATO-Luftlageerstellung im Dauereinsatz ergänzte, aber im Rahmen der Einnahme der Luftwaffenstruktur 3 Anfang der 90er Jahre aufgelöst wurde.
Die Flugsicherungsabteilungen wurden 1980 aus den FmRgt 11 und 12 herausgelöst und ihre in der überörtlichen Flugsicherung eingesetzten Flugsicherungseinheiten in dem neu aufgestellten FmRgt 81 zusammengefasst, womit die überörtliche militärische Flugsicherung erstmals eine eigenständige Organisationsform als Verband erhielt, welcher jedoch mit Aufbau und Überleitung der zivilen Flugsicherung in eine privatwirtschaftliche Organisationsform (DFS GmbH) 1994 aufgelöst wurde. Verbleibende Planungs- und Koordinationsaufgaben wurden dem Amt für Flugsicherung der Bundeswehr (AFSBw) übertragen.
1982 wurde dem LwFüDstKdo auch die Fachkommandoaufgabe für das Gebiet der Informationsverarbeitung übertragen, welche bis dahin eigenständig von der Abteilung „Informationsverarbeitung der Luftwaffe“ im Luftwaffenamt wahrgenommen worden war.
Mit der Luftwaffenstruktur 3 wurden ab 1987 die Fachaufgaben auf die Ebene der Höheren Kommandobehörden verlagert: Für das LwFüDstKdo bedeutete dies die Abgabe dieser Aufgaben an die neuen Abteilungen „Führungssysteme der Luftwaffe“ und „Personal, Ausbildung und Reservistenangelegenheiten“ des Luftwaffenamtes. Als reines Divisionskommando ab 1. Oktober 1987 behielt das LwFüDstKdo neben allgemeinen truppendienstlichen Aufgaben den Auftrag zur Einsatzführung für das
Einsatzfernmeldenetz der Luftwaffe, ab 1988 auch für das im Aufbau befindliche Automatische Führungs- und Fernmeldenetz der Luftwaffe (AutoFüFmNLw);
Rechnergestützte Führungsinformationssystem EIFEL 1;
Erfassungs- und Auswertesystem der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung der Luftwaffe (EASysFmEloAufklLw);
und für die überörtliche militärischen Flugsicherung.
Der Radarführungsdienst dagegen wurde aus dem LwFüDstKdo ausgegliedert und dem Luftflottenkommando zugeordnet, wobei aus den Fernmelderegimenter 31 — 34 zwei Radarführungskommandos jeweils für den Nord- bzw. Südbereich aufgestellt wurden, denen Radarführungsabteilungen unterstellt waren, welche die „Control and Reporting Center“ (CRC) betrieben.
Zum 1. April 1989 wurden die Fernmelderegimenter 71 und 72 in Fernmeldebereich 71 (FmBer 71) bzw. Fernmeldebereich 72 (FmBer 72) umbenannt.
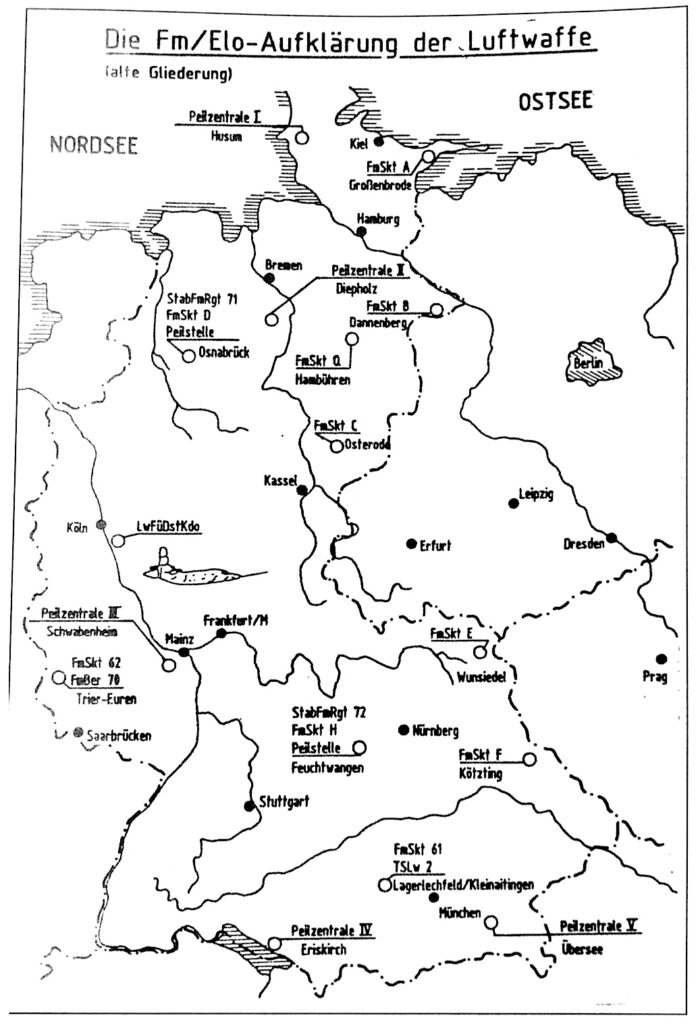

Dislozierung (1988) und Gliederung der LwFm-/EloAufkl ab Frühjahr 1989,
Graphik: Quelle 6 und 7
Noch vor der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 wurde die FmEloAufkl der Luftwaffe gegen die NVA-Luftstreitkräfte und ‑Luftverteidigung eingestellt9 und schuf der Fernmeldeverbindungsdienst der FmRgt 11 sowie 12 ab Anfang September die Voraussetzungen zur Herstellung der Führungsfähigkeit der Luftwaffe in der früheren DDR und zur Ausübung lufthoheitlicher Aufgaben über deren Territorium: Ab 3. Oktober 1990 wurde so zunächst mit mobilen Kräften — später ortsfest — eine 120-kanalige Richtfunkverbindung im Norden — die sogenannte „Nordtrasse“ zwischen Hitzacker und Karenz — zur Verknüpfung des AutoFüFmNLw mit dem Richtfunknetz der ehemaligen NVA-Luftstreitkräfte und ‑Luftverteidigung sowie damit der Fernmeldeanschluß der neuen 3. Luftwaffendivision sichergestellt. Später wurde dann auch noch eine sogenannte „Südtrasse“ zur Verbesserung der Fernmeldeanschlüsse der in der früheren DDR stationierten Luftwaffenverbändeeingerichtet.
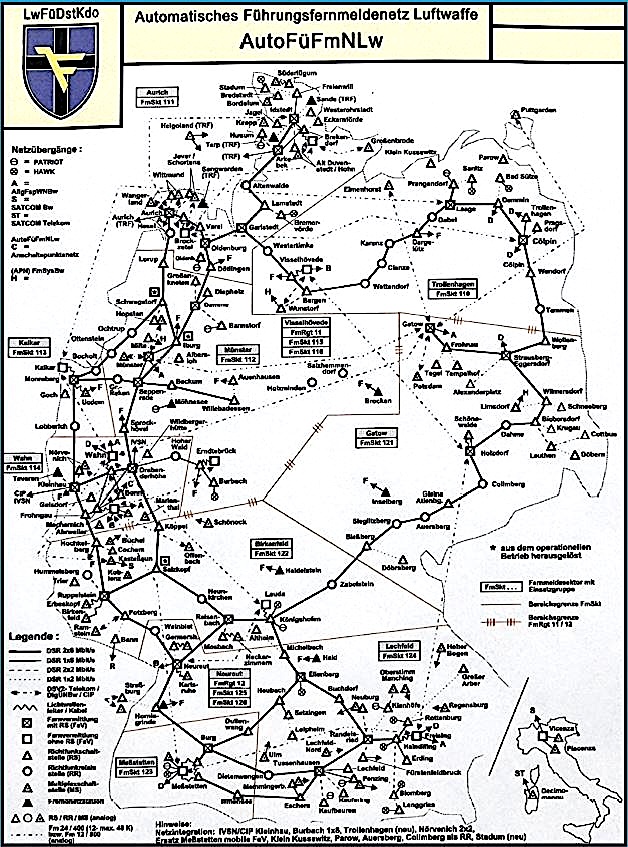
AutoFüFmNLw ab 1990, Graphik:
Bildtafel 57
Die Verknüpfung dieser beiden Fernmeldenetze einschließlich ihres weiteren Ausbaus war eine herausragende Gemeinschaftsleistung der FmRgt 11 und 12 sowie der Fernmeldekräfte des ehemaligen Nachrichtenregiments 14 der NVA-Luftstreitkräfte und ‑Luftverteidigung, aus dem dann vorübergehend die Fernmeldeabteilung 14 wurde.
Mit der neuen Zuordnung der Verbände der Luftwaffe im Rahmen der Luftwaffenstruktur 4 ab 1990 ergab sich für das LwFüDstKdo ein Unterstellungswechsel unter das Luftwaffenführungskommando (LwFüKdo), und damit eine stärkere Integration in den operativen Bereich der Luftwaffe. Gleichzeitig wurde der Kommandobereich des LwFüDstKdo so umorganisiert, daß nunmehr der Fernmeldeverbindungsdienst, die Informationstechnik- und DV-Komponenten sowie die Fernmelde- und Elektronische Aufklärung als dem LwFüDstKdo unmittelbar zugeordnete Führungsdienste truppendienstlich und fachlich geführt wurden. Dagegen waren nun der Radarführungsdienst und das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr auch fachlich dem LwFüDstKdo nicht mehr zugeordnet. Die unmittelbare Unterstellung unter das LwFüKdo mit der stärkeren Integration des LwFüDstKdo in den operativen Bereich hatte zur Folge, daß ein Teil der Aufgaben zur Sicherstellung der uneingeschränkten Führungsfähigkeit der Luftwaffe rund um die Uhr und an sieben Tagen der Woche wahrgenommen werden musste. Gleichzeitig aber sank der Personalumfang des Luftwaffenführungsdiensts von ca. 11.000 auf ca. 4.800, wobei FmRgt 11 und 12 noch über ca. 2.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter verfügten.
Nach Inkraftsetzung der STAN „FmEloAufkl 95“ vom 01.03.93 waren als Maßnahmen vorgesehen:
- Umgliederung von FmBer 70, 71 und 72 zum 01.10.93;
- Auflösung von FmBer 71 zum 01.10.94;
- erneute Umgliederung von FmBer 72 zum 01.10.94.
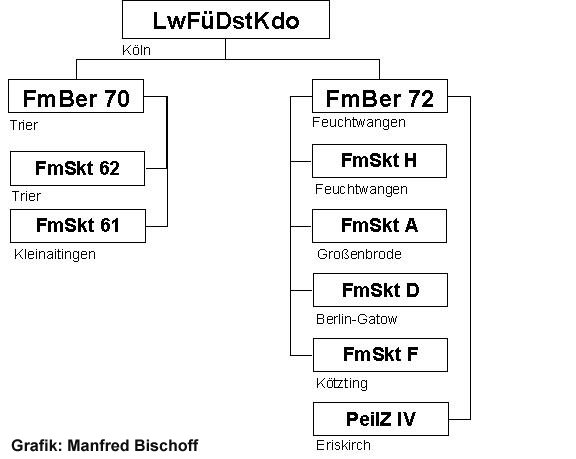
Gliederung der LwFm-/EloAufkl ab Herbst 1994,
Graphik: Quelle 7
Ab 1993 wurden dabei aufgelöst: Am
- 31.03.93 — Fernmeldesektor C und Fernmeldesektor E;
- 31.03.94 — Fernmeldesektor B und Fernmeldesektor Q;
- 31.03.97 — Peilzentrale IV;
- 30.09.97 — Fernmeldesektor H.
Von Oktober 1997 bis Ende Juni 2002 standen somit der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung der Luftwaffe von ehemals acht nunmehr nur noch drei Fernmeldesektoren für die mobile und stationäre Erfassung zur Verfügung.
Zum 30.09.1994 war bereits der Stab des Fernmeldebereichs 71 aufgelöst worden und zum 31.12.1997 wurde auch der des Fernmeldebereichs 72 aufgelöst. Der Fernmeldesektor D wurde umgegliedert und bis zum 31.12.97 nach Berlin-Gatow verlegt, nachdem dort der Fm-/EloAufkl-Betrieb bereits 1993/94 aufgenommen worden war. Die verbliebenen Fernmeldesektoren A, F und D und 61 wurden dem Fernmeldebereich 70 in Trier unterstellt. Die Anfang der 90er Jahre hinzugekommenen mobilen (verlastbaren) Erfassungskomponenten wurden bei den beiden Fernmeldesektoren A und F stationiert.
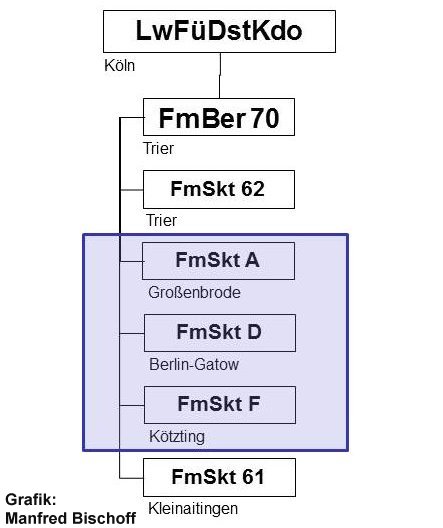
Gliederung der LwFm-/EloAufkl ab Anfang 1998,
Graphik: Quelle 7
Neben der Führung der unterstellten Verbände und der Aufgabe, das Automatische Führungs- und Fernmeldenetz der Luftwaffe (AutoFüFmNLw) und das Führungsinformationssystem der Luftwaffe (FüInfoSysLw) zu betreiben, nahm das LwFüDstKdo seit 1998 auch die Fachkommandofunktion für Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und für die Fernmelde- und Elektronische Aufklärung der Luftwaffe wahr.

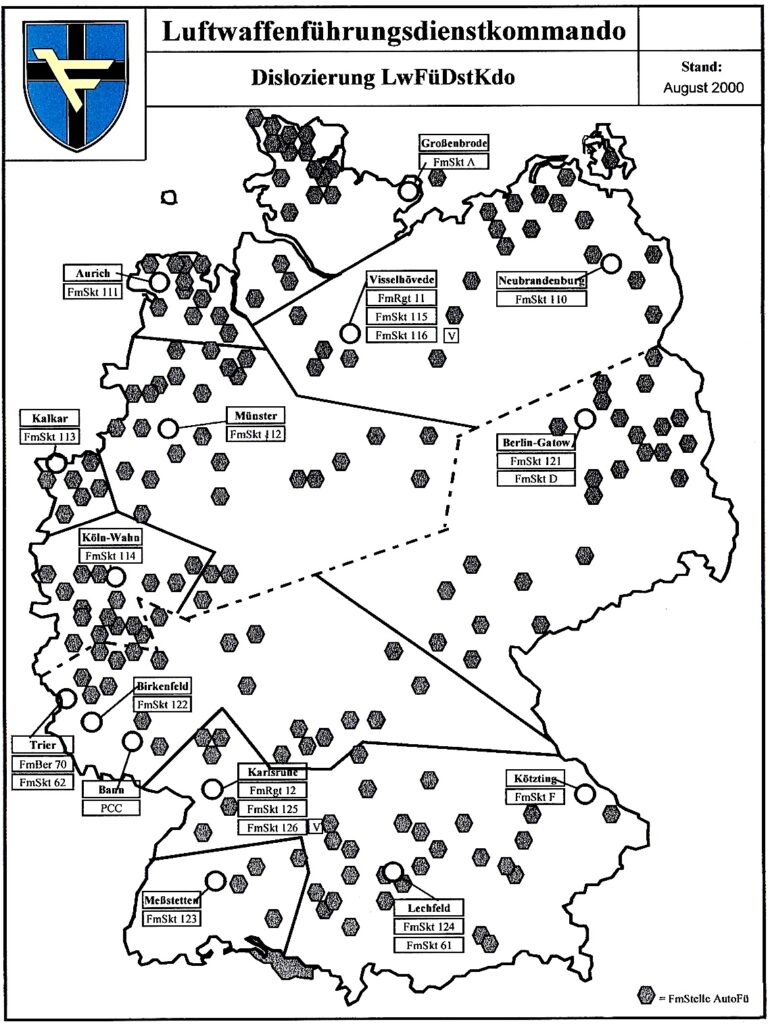
Gliederung und Dislozierung von LwFüDstKdo in 2000,
Graphiken: Quelle 7
Letztere wurde im Juli 2000 in das LwFüKdo überführt und dort mit der Fachaufgabe „Elektronischer Kampf“ zusammengefasst.
Im Rahmen der Einnahme der Luftwaffenstruktur 5 wurde das LwFüDstKdo am 30. Juni 2002 aufgelöst. Die Nachfolge trat der Führungsunterstützungsbereich der Luftwaffe (FüUstgBerLw) an, dem die ebenfalls in das mobile und das ortsfeste AutoFüFmNLw-Bataillon umgegliederten Fernmelderegimenter 11 und 12 unterstellt wurden, während der Fernmeldebereich 70 mit Masse an die Streitkräftebasis übergeben wurde. Der bis dahin auch FmBer 70 unterstellte Fernmeldesektor 62 verblieb dagegen in der Luftwaffe und wurde als “Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme der Bundeswehr” direkt dem Luftwaffenführungskommando unterstellt.
Im Zuge einer Organisationsänderung der Marine wurden am 1. Oktober 1974 die zuvor den Marinedivisionen Nord- und Ostsee unterstellten landgebundenen Fernmelde‑, Fernmelde- und Elektronischen Aufklärungskräfte sowie der landgebundene Ortungsdienst im Marineführungsdienstkommando zusammengeführt, das in Kiel aufgestellt wurde sowie truppendienstlich und für den Einsatz dem Flottenkommando in Glücksburg unterstand.
Ende Mai 1987 wurde die Peilzentrale Nord in Lunden aufgelöst und gleichzeitig die Peilzentrale I (PZI) in Husum aufgestellt sowie ab Juni 1987 auf die HF-Bundeswehrpeilbasis umgerüstet.
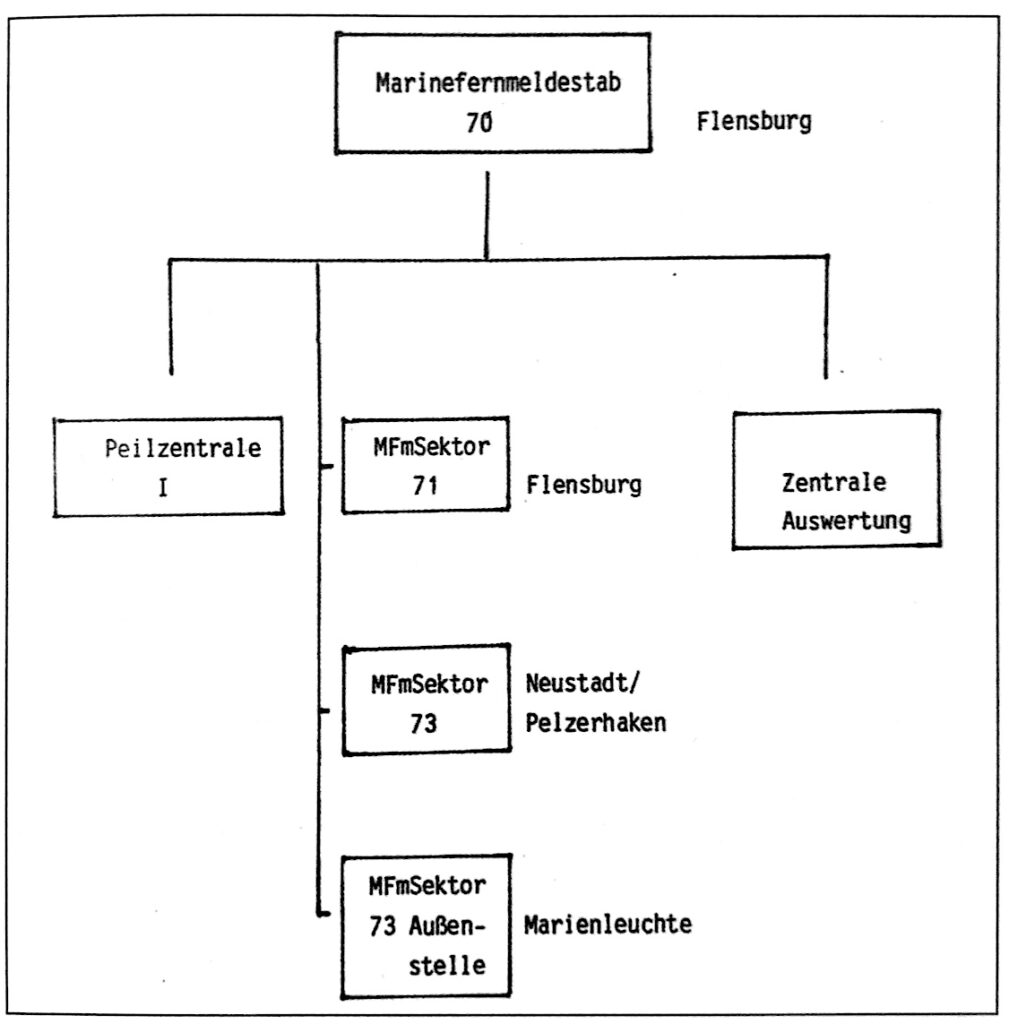

Gliederung und Dislozierung der Fm-/EloAufkl der Marine 1988, Graphiken: Quelle 6
Im Zeitraum Juni 1988 — Anfang Oktober 1989 wurden die alten Meßboote „Alster“, „Oker“ und „Oste“ außer Dienst und die neuen Flottendienstboote „Alster“, „Oker“ und „Oste“ in Dienst gestellt.
Ende 1989 begann der Bau der Großpeilanlage Kastagnette in Bramstedtlund bei Leck.
Die Fernmelde- und Elektronische Aufklärung der Bundesmarine gegen die Volksmarine der DDR wurde am 8. August 1990 um 23:59 eingestellt, Ende September 1991 die Erfassung im MFmSkt 73 in Neustadt, der dann am 30. September 1992 aufgelöst wurde.
Ab 1. April 1991 wurde im Zuge des Aufbaus neuer Marinestrukturen in der früheren DDR aus Teilen des vormaligen Marinenachrichtenregiments 18 der DDR-Volksmarine Marinefernmeldeabschnitt 3 in Rostock aufgestellt, der truppendienstlich dem Marinekommando Rostock und für den Einsatz dem Flottenkommando unterstand. Am 1. Oktober 1994 wurde er aber bereits wieder aufgelöst und aus den verbleibenden Teilen Marinefernmeldegruppe 30 aufgestellt, die in den Marinefernmeldeabschnitt 1 integriert und damit dem Marineführungsdienstkommando unterstellt wurde. Sie war für den gesamten Fernmeldebetrieb der Bundesmarine in der früheren DDR zuständig und betrieb dazu die Fernmeldezentrale Rostock-Gehlsdorf im 24-Stunden Schichtbetrieb, die Marinefunksendestellen in Marlow sowie Hohe Düne, die Marinefunkempfangsstelle Rostock-Gehlsdorf und zwei Fernsprech- sowie Fernschreibstellen. Außerdem war sie für das Taktische Richtfunknetz des Flottenkommandos im Regionalbereich Ost und für die Wartung sowie Instandsetzung der Funksende- und Empfangsstellen in diesem Bereich verantwortlich. Sie wurde am 14. November 2001 aufgelöst.
In den 1990-er Jahren wurden die drei Marinefernmeldestellen des Marinefernmeldesektor 71 nach und nach aufgelöst und durch die Großpeilanlage „Kastagnette“ in Bramstedtlund bei Leck mit einem Aufklärungsgebiet vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer ersetzt, wohin auch der Marinefernmeldesektor 71 am 1. Dezember 1994 verlegte und die “Kastagnette” übernahm, wo ab Mitte März 1995 der Erfassungsbetrieb aufgenommen und ihre Peilfähigkeit bis Mitte Dezember 1995 hergestellt wurde.


Großpeilanlage „Kastagnette“ in Bramstedtlund, Bilder: Quelle 7
Zum 31. März 1995 wurde das Marineführungsdienstkommando aufgelöst und als Nachfolgeorganisation die Flottille der Marineführungsdienste (MFüDstFltl) zum 1. April 1995 aufgestellt: Zu diesem Zeitpunkt dienten etwa 1.600 Soldaten und 600 zivile Beschäftigte in dem Verband. Im Zuge dieser Umgliederungen übernahm der Marinefernmeldeabschnitt 1 ab Mitte der 1995er Jahre auch alle operativen Aufgaben vom Marinefernmeldeabschnitt 2 und gab alle betrieblichen Aufgaben an diesen ab.

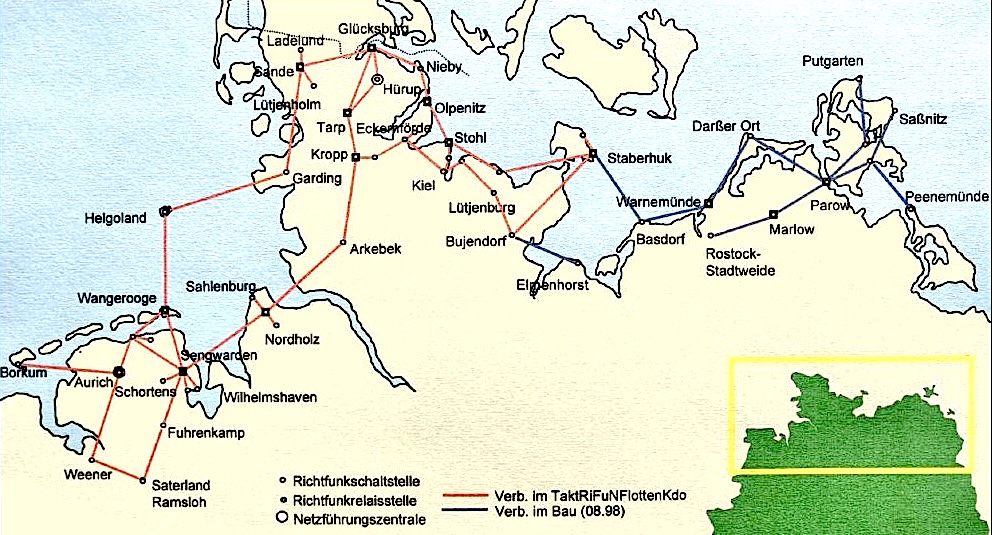
Marinefunksende- und empfangsstellen sowie Taktisches Richtfunknetz des Flottenkommandos Ende der 1990-er Jahre,
Graphiken: Bildtafel 56
Bei der Auflösung der MFüDstFltl Ende März 2002 wurde der Marinefernmeldeabschnitt 1 wieder direkt dem Flottenkommando unterstellt und in den Flottenstab eingegliedert, während der Marinefernmeldeabschnitt 2 direkt dem Marineamt unterstellt und in dessen Stab eingegliedert wurde, womit beide Ende September 2002 aufhörten, als Verband zu bestehen.
Bei der Auflösung des Marinefernmeldeabschnitts 2 und der Eingliederung verbliebener Elemente in das Marineamt im Jahr 2002 blieb die Marinefernmeldegruppe 21 als selbständige Einheit in Sengwarden bestehen und wurde später als Führungsunterstützungszentrum dem Flottenkommando unterstellt. Ende März 2013 wurden die Aufgaben an das neue Marine-Führungsunterstützungszentrum Glücksburg übergeben, der Sendebetrieb eingestellt und die Einheit aufgelöst.
Marinefernmeldestab 70 wurde am 31. März 2002 von der Marine an die Streitkräftebasis übergeben und in Fernmeldebereich 91 umbenannt, der im Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik stationiert wurde, wo er am 21. März 2013 aufgelöst wurde, wobei große Teile als neues Bataillon Elektronische Kampfführung 911 (EloKaBtl 911) nach Stadum gingen. MFmSkt 71 wurde in Fernmeldeaufklärungsabschnitt 911 (FmAufklAbschn 911) umbenannt und dem FmBer 91 unterstellt. Auch das später neu aufgestellte Bataillon Elektronische Kampfführung 912 (EloKaBtl 912) in Nienburg/Weser wurde FmBer 91 unterstellt, wohin auch die Bordeinsatzteams “See” für die Flottendienstboote und “Luft” für die Breguet 1150 M Atlantic verlegt wurden.
Insgesamt hatte sich so im Zeitraum 1957 — 1989 sowohl in der Marine, als auch in der Luftwaffe aus einfachsten Anfängen am Ende der 1950-er Jahre ein komplexes organisatorisches und technisches System an Führungsdiensten entwickelt, das der militärischen Führung einerseits Fernmeldeverbindungen und Informationsverarbeitungssysteme zur Sicherstellung ihrer Führungsfähigkeit zur Verfügung gestellt hat sowie andererseits wesentliche Informationen zur Lagefeststellung und ‑beurteilung – vor allem in außenpolitischen Krisensituationen (z.B.: Berlin 1961, CSSR 1968 u8nd Polen 1980/81) – geliefert hat und Ende der 1980-er Jahre nahezu alle seine damaligen Fm-/EloAufkl-Forderungen im Rahmen des Ständigen Aufklärungsauftrages erfüllen konnte.
Der Zeitraum 1990 bis etwa Anfang/Mitte der 2000-er Jahre war dann sowohl durch Reduzierungen und Umgliederungen der Führungsdienste von Marine und Luftwaffe, als auch durch die Ausgliederung ihrer bisherigen Fm-/EloAufkl-Verbände in die Streitkräftebasis gekennzeichnet.
Die auf den Bildtafeln über die Führungsdienste von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr dokumentierte Geschichte endet somit etwa Anfang bis Mitte der 2000-er Jahre – somit ist es an den heutigen, fachlich Verantwortlichen für die Führungsdienste von Marine und Luftwaffe, die Fortschreibung ihrer Geschichte für die inzwischen 20 Jahre seit 2005 aufzugreifen, um zu vermeiden, daß die geschichtlichen „Fäden“ komplett abreißen.
Quelle:
Tafel 56 und 57 der Bildtafelausstellung “Fernmeldetruppen – Gestern und heute”
Weitere Quellen und zusätzliche Informationen zum Thema:
- N.N.: Die Führungsdienste der Luftwaffe — Abriß der Entwicklung der Luftnachrichtentruppe und der Führungsdienste der Luftwaffe von den Anfängen bis 1999, in: Telegraphen-/Nachrichten-/Fernmeldetruppen und Führungsdienste — Führungsunterstützung seit 1899, Hrsg.: Fernmeldering e.V. 1999 — S. 151 ff.
- N.N.: Führungsmittel der Marine — von den Anfängen bis 1999, in: Telegraphen-/Nachrichten-/Fernmeldetruppen und Führungsdienste — Führungsunterstützung seit 1899, Hrsg.: Fernmeldering e.V. 1999 — S. 169 ff.
- N.N.: Geschichtliche Zeittafel über die Entwicklung der Telegraphen‑, Nachrichten‑, Fernmeldetruppe und Führungsdienste 1830 — 1999, in: Telegraphen-/Nachrichten-/Fernmeldetruppen und Führungsdienste — Führungsunterstützung seit 1899, Hrsg.: Fernmeldering e.V. 1999 — S. 225 ff.
- Grabau, Rudolf: Die Fernmeldetruppe EloKa des Heeres 1956 bis 1990 – Organisations- und Ausbildungsübersichten / Ein Beitrag zur Geschichte der Bundeswehr — Geschichte der Truppenteile, Organisation, Ausbildung, Personal; Hrsg.: Fernmeldering e.V. — 1. Auflage 1995, Seite 197 ff.
- Grabau, Rudolf: Der Neubeginn der FmEloAufl und der EloKa der Luftwaffe ab 1956 und das dem Neuaufbau zugrundeliegende Konzept, Hrsg.: Fernmeldering e.V. — 2000
- Weiße, Günther K.: Geheime Funkaufklärung in Deutschland (ISBN 3–613-02531–0), Motorbuch-Verlag – 1. Auflage 2005
- Bischoff, Manfred: Homepage zu Fernmelde- und Elektronische Aufklärung sowie Funk- und Funktechnische Aufklärung unter www.manfred-bischoff.de/index1.htm
- Bischoff, Manfred: DIE GESCHICHTE DER FERNMELDE- UND ELEKTRONISCHEN AUFKLÄRUNG DER MARINE unter www.manfred-bischoff.de/MFmStab70.htm
- Carroll, John M.: Der Elektronische Krieg, Ullstein 1967
- Bonatz, Heinz: Die deutsche Marinefunkaufklärung 1914 — 1945, in: Beiträge zur Wehrforschung — Band XX/XXI (ISSN 0067–5253), Hrsg.: Arbeitskreis für Wehrforschung, Darmstadt 1970
- Stallmann, Wilfrid: Elektronische Kampfführung — Entwicklung und Einfluß auf die Seetaktik, in: Truppenpraxis 7/74, S. 556 ff.
- Ganter, Karl/Wollschläger, Peter J.: Elektronische Kampfführung, in: Truppenpraxis 10/74, S. 769 ff.
- Willberg, Hans-Friedrich: Geschichte der Elektronischen Kampfführung, in: Jahrbuch der Luftwaffe 1976/77, S. 122. ff
- Thurbon, M.T.: The Origins of Electronic Warfare, in: RUSI Journal 9/77, S. 56 ff.
- Taube, Gerhard: Aus der Kriegs- und Wehrgeschichte – Hochfrequenzschlacht im Zweiten Weltkrieg: Kampf mit und um Radar in der Luftwaffe (Buchreportage), in: Wehrausbildung in Wort und Bild 1/78, S. 26 ff.
- Werther, Waldemar: Die Entwicklung der deutschen Funkschlüsselmaschinen — Die „Enigma“, in: Die Funkaufklärung und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg (ISBN 3–87943-666–5), Hrsg.: Rohwer, Jürgen/Jäckel, Eberhard — Stuttgart 1979, S. 50 ff.
- Jones, Reginald V.: Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren der im Zweiten Weltkrieg angewandten Verfahren elektronischer Kampfführung, in: Die Funkaufklärung und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg (ISBN 3–87943-666–5), Hrsg.: Rohwer, Jürgen/Jäckel, Eberhard — Stuttgart 1979, S. 228 ff.
- Lehr- und Ausbildungshilfe A 11 „Kriegsgeschichtliche Beispiele der Elektronischen Kampfführung“, S. 18 ff. und Anlage D; FmS/FSHEloT — Spezialstab ATV, Februar 1979
- Bonatz, Heinz: Seekrieg im Äther — Die Leistungen der Marine-Aufklärung 1939 — 1945 (ISBN 3–8132-0120–1) — 1. Auflage, Herford 1981
- Lewin, Ronald: Entschied ULTRA den Krieg ? — Alliiierte Funkaufklärung im 2. Weltkrieg (ISBN 3–8033-0314–1), Hrsg.: Rohwer, Jürgen — Koblenz/Bonn 1981
- Trenkle, Fritz: Die deutschen Funkstörverfahren bis 1945, Ulm 1981
- Trenkle, Fritz: Die deutschen Funkpeil- und ‑Horch-Verfahren bis 1945, Ulm 1981/82
- Mäkelä, Matti E.: Das Geheimnis der „Magdeburg“ — Die Geschichte des Kleinen Kreuzers und die Bedeutung seine Signalbücher im Ersten Weltkrieg (ISBN 3–7637-5424–5), Koblenz 1984
- Arcangelis, Mario de: Electronic Warfare — From the Battle of Tsushima to the Falklands an Libanon Conflicts, Poole/ Dorset — 1985, S. 20 ff.
- Boog, Horst: Der geheime Nachrichtendienst der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, in: Truppenpraxis 4/1986, S. 387 ff.
- Trenkle, Fritz: Die deutschen Funkmeßverfahren bis 1945 (ISBN 3–7785-1400–8), Ulm 1986
- Trenkle, Fritz: Die deutschen Funkführungsverfahren bis 1945 (ISBN 3–7785-1647–7), Ulm 1987
- Paulini, Rudolf/Timm, Norbert: Fernmeldedienst im Wandel der Zeit, in: Wehrausbildung 1/1988, S. 31 ff.
- Emelin, Alexej Jurjewitsch: Die Legenden des Kreuzers „Magdeburg“ unter https://web.archive.org/web/20120206142344/http://submarine.50megs.com/magdebu.htm
- Wikipedia-Einträge zu „Room 40“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Room_40 und https://en.wikipedia.org/wiki/Room_40
- Wikipedia-Eintrag zu „Battle of Dogger Bank (1915)“ unter https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dogger_Bank_(1915)
- Wikipedia-Eintrag zu „Battle of the Falkland Islands“ unter https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Falkland_Islands
- Wikipedia-Eintrag zu „Battle of Jutland“ unter https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Jutland
- Herold, Klaus: Der Längstwellen-Sender GOLIATH bei CALBE an der Milde von 1941 bis 1945 unter www.cdvandt.org/Goliath.pdf
- Krüger, Henning: Geschichte(n) über Kalbe (Milde) — Der „Goliath“ oder die Geschichte einer Wiese, 2020 unter: www.kalbe-milde.de/gol.php
- Niemetz, Dr. Daniel: Längstwellensender Goliath — Stärkster U‑Boot-Sender der Welt funkte aus der Altmark unter: www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/verlauf/laengstwellensender-goliath-u-boot-kalbe-milde-altmark-russland-100.html
- Wikipedia-Eintrag zu „Goliath“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Goliath_(Funk)
- Wikipedia-Eintrag zu „Chiffrierstelle der Luftwaffe“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Chiffrierstelle_der_Luftwaffe
- Wikipedia-Eintrag zu „Luftnachrichtenabteilung 350“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Luftnachrichtenabteilung_350 und
https://en.wikipedia.org/wiki/Luftnachrichten_Abteilung_350 - Wikipedia-Eintrag zu „Battle of the Beams“ unter https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Beams
- Wikipedia-Eintrag zu „Marinefernmeldestab 70“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Marinefernmeldestab_70
- Wikipedia-Eintrag zu „Marineführungsdienstkommando“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Marineführungsdienstkommando
- Wikipedia-Eintrag zu „Luftwaffenführungsdienstkommando“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffenführungsdienstkommando
- Entstehung des Führungsdienstes der Luftwaffe unter https://web.archive.org/web/20091220194636/http://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/org/fueub/hist?yw_contentURL=/01DB060
Endnoten:
1 Eine Reusenantenne besteht aus mehreren Drähten, den sogenannten Reusenseilen, die meist radialsymmetrisch angeordnet sind. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um eine parallele und radialsymmetrische Anordnung von Drähten, die an ihren Enden jeweils durch einen Ring getragen werden und hinter diesen Ringen zu den Außenseiten hin zusammengefasst und gespannt werden. Diese Anordnung wird auch als Käfigreuse bezeichnet. Aus Käfigreusen lassen sich Dipolantennen mit großer Bandbreite zusammenschalten. Eine besondere Ausführung der Reusenantenne ist die Flachreuse. Hierbei sind die Antennendrähte in einer Ebene nebeneinander angeordnet und werden entsprechend nicht mit Ringen, sondern Stäben getragen und zusammengefasst.
2 Die Werftdivisionen für Ostsee- und Nordseeflotte waren zur Ausführung von Werftarbeiten vorgesehen und hatten auch die Besetzungen der Schiffe mit Handwerkern, Maschinisten sowie Heizern vorzunehmen.
3 Der Deckoffizier war ein unmittelbar hinter den Seeoffizieren der Kaiserlichen Marine, Reichs- und Kriegsmarine rangierender Marinedienstgrad. Häufig aus der Laufbahn der Matrosen aufgestiegen, beriet er als Spezialist seines Fachs den Kommandanten oder die anderen mit der Schiffsführung betrauten Offiziere. In Deutschland bildeten die Deckoffiziere von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1938 eine eigene Rangklasse, die international der Dienstgradgruppe der „Warrant Officers“ entsprach. Die heutige Deutsche Marine kennt den Deckoffizier nicht mehr, jedoch den Decksoffizier, welcher ein „Abschnittsleiter“ (= Teileinheitsführer) für den seemännischen Dienst an Bord ist sowie in der Regel durch Leutnante/Oberleutnante zur See des Truppendienstes besetzt wird, und den Decksmeister als Funktionsbezeichnung für die dienstältesten Unteroffiziersdienstgrade im seemännischen Dienst an Bord.
4 am 1. April 1936 Beförderung zum Oberst, am 1. März 1938 zum Generalmajor, am 1. April 1940 zum Generalleutnant und am 20. September 1941 zum General der Luftnachrichtentruppe (entsprechend „General der Nachrichtentruppe“), ab November 1941 Sonderbeauftragter für Funkmeßtechnik und ab 11. März 1944 Generalnachrichtenführer der Luftwaffe
5 „DLV-Fliegerschaft“: Korporative Unterorganisation des DLV, zu der im Zeitraum 1933 — 1935 Soldaten des Reichsheeres bei Wechsel in den Bereich des Reichsluftfahrtministeriums unter formaler Verabschiedung aus dem aktiven Dienst „versetzt“ wurden
6 Unmittelbar nach dem 1. September 1939 verlegte die OKL-Chiffrierstelle von Berlin nach Potsdam in den Marstall des Stadtschlosses und wurde im November 1944 in LnAbt 350 umbenannt.
7 In den Luftnachrichten-Regimentern der Luftflotten gab es jeweils eine Fliegerstaffel, die vor allem mit diesen sogenannten „Nachrichten-Ju 52“ ausgestattet war, um Nachrichtenverbindungen zu nicht ausgebauten, eingenommenen Flugplätzen herzustellen.
8„Ball-Radar-Störanlage“: Nach Empfang der gegnerischen Radarimpulse und ihrer Verfünffachung mittels einer Laufzeitkette Tastung des Störsenders mit den fünf Impulsgruppen auf der Empfangsfrequenz, dadurch Erzeugung von fünf künstlichen Radarechos.
9 Gegen die sowjetischen bzw. russischen Luftstreit-/-verteidigungskräfte in der ehemaligen DDR sowie in Tschechien und Polen wurde sie dagegen bis zu ihrem Abzug im Zeitraum 1991 — 1994 fortgeführt.
